Jasper Fabian Wenzel
Journalist und Autor
Robert Habeck im Porträt: Scheißegal, ich rede so
BERLINER ZEITUNG AM WOCHENENDE (2021)
Schattenmänner: Unter Lobbyisten
BERLINER ZEITUNG AM WOCHENENDE (2021)
Knaufts Wende
KRAUTREPORTER (2015)
Der Hirnprofi
KRAUTREPORTER (2015)
Immer noch Sturm
WELT AM SONNTAG (2012)
SCHEISSEGAL, ICH REDE SO
Robert Habeck fremdelt mit der verzagten Wahlkampagne seiner Partei. In Schleswig-Holstein kämpft der verhinderte Kanzlerkandidat der Grünen um ein Direktmandat. Sein Führungsanspruch zeigt sich unvermindert.
Ich kenne ihn, aber er kennt mich nicht“, sagt Uta Bergfeld. Die Geschäftsstelle der Grünen in Schleswig liegt neben dem Schuh- und Schlüsselprofi im Stadtzentrum, Robert Habeck hat Berlin am Telefon, Uta Bergfeld gießt noch eben die Blumen.
Die Schleswiger Grünen und die Referenten aus der Hauptstadt, die ihren Parteivorsitzenden an diesen Julitagen begleiten, stehen sich etwas scheu gegenüber. Die Schleswiger sprechen offen, die Berliner möchten lieber nicht so viel sagen.
Uta Bergfeld lehnt an der Hauswand in der Sonne, zündet sich eine Zigarette an und spricht über den, der da telefoniert, der sie mit Anfang fünfzig noch in die Politik getrieben hat. Bergfeld ist Habecks Nachfolgerin als Kreisvorsitzende. Sie sagt: „Das Tolle ist ja, dass ich als Ehrenamtliche auch mal sagen kann: ‚Robert, da hab ich kein’ Bock drauf.‘“
Nicht wenigen geht die Berliner Parteizentrale, die alles steuern möchte, dabei aber selbst überlastet ist, gerade ein bisschen auf die Nerven. Viele Grüne im Norden arbeiten im Tourismus und machen in der Hochsaison auch noch Wahlkampf bis zur Erschöpfung. Da gibt es die Listenkandidatin, die sich beim Plakateaufhängen eine Rippe bricht, es gibt Uta Bergfeld, die sich Grippostad C und Paracetamol eingeworfen hat, und es gibt ein paar brummige Freiwillige von der Grünen Jugend, die sagen: „Nicht mal über die Playlist, die vor Roberts Auftritten gespielt wird, bestimmen wir. Das kommt alles aus Berlin.“
Robert Habeck sieht aus, als wäre ihm gerade aufgefallen, dass alles gar nicht so übel läuft für ihn. Nach einer Urlaubswoche mit Campingkocher, wie er bei Markus Lanz freimütig erklärte, wird er bemerkt haben, wie angenehm seine neue Rolle sein kann: Nummer zwei, aber doch gefühlte Nummer eins. Er wippt, er federt, ein Mercutio in einem neuen ersten Akt, ganz schön frei.
Man sieht den früheren Landesminister für Energiewende, Landwirtschaft und Umwelt vor Leuchttürmen, im Wattenmeer, im Sandstrand sitzen, Habeck im Regen, Habeck im Wind. Er war in Flensburg, wo er wohnt, war in Heikendorf bei Kiel, seinem Heimatort, und nun also Schleswig, wo vor zwei Jahrzehnten sein politischer Lebenslauf begann. Er kämpft hier, Wahlkreis 1, um ein Direktmandat, was ein Prestigeerfolg wäre, was nach der Wahl noch wichtig werden könnte für ihn.
Rausgehen, ein bisschen streiten
Am Vormittag steht Habeck im Stall zwischen Heuballen und vierzinkiger Mistgabel und sagt: „Wollen wir mal rausgehen und ein bisschen streiten?“ Auf dem Vorplatz umkreist ihn eine Schar Milchbauern und Journalisten. Wahlkampf auf einem Biohof, fast so wie vor der Pandemie.
Habeck weiß: vor Kameras nicht ins Gesicht fassen. Er hat, etwas gedrückt und schräg nach vorn gelehnt, die Hände in den Hosentaschen. Was bei Armin Laschets Ortsterminen wie versteckt, verzagt und zugeknöpft, nach echtem Unwohlsein aussehen kann, wirkt bei Habeck sportlicher, er trägt einen dunkelblauen Pulli und schwarze Jeans, seine Daumen gucken dabei aus den Taschen raus. Man kann dem jungen Barack Obama in einem aktuellen Porträt des amerikanischen Fernsehsenders HBO bei einer Rede zusehen, wie er nach jeder Geste die rechte Hand in der Hosentasche verschwinden lässt, um sie für die nächste Pointe sogleich wieder rausschießen zu lassen: Deklamation und Nachwirkung, Pose des Wechsels von Dringlichkeit und Lässigkeit, von öffentlich und intim. Es ist diese Inszenierung vom unverkrampften Handeln, die zum Erfolg der Obamas, Macrons und Trudeaus dieser Welt beigetragen hat. Man möchte schließlich niemanden wählen müssen, der den Eindruck macht, er sei überforderter als man selbst.
Habeck bedient diese Bilder des scheinbar Mühelosen. Dass sich Großes auch cool angehen lässt. Er fläzt gerne, sitzt schief und telefoniert mit einem Bein auf kniehohen Mauern. Er findet es selbst lustig, dass man als Politiker mit Anfang fünfzig noch jungenhaft wirken kann („Gibt es ja sonst nur bei Schriftstellern“). Während Habeck noch mit den Landwirten über Milchproduktpreise spricht, legt sich ihm eine Berner Sennenhündin vor die Füße und bleibt für den Rest des Gesprächs dort liegen. Mehr machtbewusste Ruhepose inmitten der Meute geht nun wirklich nicht.
Vielleicht ist Robert Habeck zum letzten Mal so zu erleben in diesem Wahlkampf. Mit der Macht wächst die Unnahbarkeit, er weiß das. Vor zehn Jahren sagte er dem Reporter, er hoffe, nie einen Personenschützer haben zu müssen. In Schleswig begleiten ihn schon zwei.
Ungeduldiger Ansturm nach den Wartejahren
„Mir ist es nicht gelungen, meine politische Vita so zu erklären, dass sie in Berlin verstanden wurde“, hatte Habeck nach der Nominierung Annalena Baerbocks zur Kanzlerkandidatin gesagt. „Wie so ein Novize“ habe er sich behandelt gefühlt, als einer, dessen Zeit als Fraktionschef, Minister und Vize-Ministerpräsident in Schleswig-Holstein nicht ausreichend gewürdigt wurde. „Ständig war ich der Schriftsteller, der Philosoph. Dass ich erfolgreich zwei Regierungen geschmiedet habe, hat plötzlich niemanden mehr interessiert.“
Was er sagen will: Natürlich wäre er mit seiner Regierungserfahrung der bessere Kanzlerkandidat gewesen. Habeck sieht jetzt nach Ärger aus, das sitzt noch immer. „Scheißegal“, sagt er. Seine Sprecherin fragt, ob er ein Eis möchte.
„Nö!“
In den zurückliegenden Jahren ist Habeck ohne Mandat ins Risiko eines langen Wahlkampfs für sich selbst gegangen. Baerbock sitzt im Bundestag, Habeck in den Talkshows. Es sind Pendeljahre, ICE und Regionalexpress, in Flensburg sieht man Habeck nicht selten vor dem Bahnhof mit dem Telefon auf dem Randstein sitzen. Er sagt, er wünscht sich Applaus fürs Regieren, nicht fürs Reden, und so wirken die Auftritte im Norden wie ein ungeduldiger Ansturm nach den Wartejahren.
Habeck wäre gerne schon 2017 Spitzenkandidat geworden, unterliegt in der parteiinternen Urwahl Cem Özdemir um gerade mal 75 Stimmen. Nach den enttäuschenden 8,9 Prozent bei der Bundestagswahl drängelt er weiter: „Wir können uns doch nicht damit zufriedengeben, dass wir nur dann Erfolg haben, wenn gerade irgendwo ein AKW explodiert.“ Zustimmungswürdig werden außerhalb des Ausnahmezustands und jenseits der grünen Milieus ist Versprechen und Forderung zugleich an seine Partei, als er im Januar 2018 im Duett mit Baerbock zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt wird. Wie einst Joschka Fischer hat Habeck eine größere Reichweite als die grüne Kernwählerschaft. Wie einst Fischer fordert Habeck seine Partei inhaltlich und stilistisch heraus. Und noch immer fürchten manche Grüne: Wer aus der Nische kommt, löst sich auf.
Die ersten Monate der Doppelspitze sind ein medialer Erfolg, vor allem für Habeck, der von allen Seiten überfrachtet wird mit Hoffnungen. Kaum einer erwartet damals, dass die Große Koalition die Wahlperiode überdauert. Im Hitzesommer 2018 holen die Grünen bei den Landtagswahlen in der Mitte Münchens 42,5 Prozent und noch einmal 42,5 Prozent im Landkreis Wentorf bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein – Richtwerte für ein neues Grünes Selbstverständnis. 2019 beginnt mit einem Hackerangriff auf das Privatleben Habecks und seiner Familie, aber es ist auch das Jahr eines politischen Highscores, den 20,5 Prozent der Grünen bei der Europawahl.
Dann kommt Corona. Keine einfache Zeit für jemanden, der von sich sagen kann, seine Form, Politik zu machen, ist die Begegnung. Habeck, dessen Arbeitsplatz die Bühne war, wirkt ohne Regierungsfunktion randständig, wenn er reinruft in die Pandemieberichterstattung. Seine Gegner erzählen jetzt über ihn die Geschichte des Romanciers und Philosophen, die ihn noch immer so aufregen kann. Das hat auch das Team um die Netzwerkerin Baerbock gekonnt bespielt und um die Co-Vorsitzende das Gegenimage der fleißigen Sachpolitikerin aufgebaut. Habeck hat sich der Parteilogik widersetzt und über viele Jahre in unzähligen Formaten ausleuchten lassen. Mit seiner sorgfältig kuratierten Selbstauskunft stößt er im ersten Pandemiejahr ans Ende der Verwertbarkeit. Er wirkt einstweilen durchfühlt. Lange konnte Habeck medienwirksam profitieren von seiner Eigenwilligkeit, aber vielleicht hat er in der entscheidenden Phase des Machtspiels mit Baerbock den Einfluss der Talkshowauftritte überschätzt und sich etwas zu lange aufgehalten mit der Frage: Wie erneuere ich die Erzählung meiner politischen Identität bis zur Kanzlertauglichkeit?
Die Gunst für Politiker ist nie bedingungslos. Manchmal gibt es einen Vertrauensvorschuss aufgrund von Charisma, einer großen Leistung oder eines persönlichen Schicksalsschlags. Aufsteiger müssen sich besonders beweisen und zugleich an den Druck gewöhnen, täglich neu vermessen zu werden. Für Habeck ist die Ohnmacht gegenüber der veröffentlichten Meinung oft nur schwer zu ertragen. Hier endet die Geschichte des leichthin Coolen, von casual und nett, hier wird Habeck zum Kontrolletti, der sich in mancher Inszenierung verrennt.
Druckreife Erinnerungen
Es ist Abend geworden an der Uferpromenade der Schleswiger Königswiesen. Habeck steht auf einer kleinen Freilichtbühne. Er sagt jetzt, er habe, während er seiner Vorrednerin zuhörte, darüber nachgedacht, warum er eigentlich eingetreten sei bei den Grünen damals. Er spricht von seinem „Fridays-for-Future-Moment“, dem Reaktorunglück von Tschernobyl. Nach einer Aufführung von Shakespeares „Sommernachtstraum“ am Heikendorfer Gymnasium wenige Wochen nach der Katastrophe regnete es nur ganz leicht, aber genug, um Habecks hormonbewegten Schülertraum vom Tanzen in Pfützen und Küssen im Regen zu zerstören – die Leute liefen aus Angst vor der unsichtbaren Gefahr davon, und Habeck dachte, hier nimmt ihm eine unsichtbare Kraft seine Selbstbestimmung, seine Jugend, seine Freiheit. Eine starke Szene. Steht nur leider schon Wort für Wort auf Seite 21 in Habecks Sachbuch „Wer wagt, beginnt“.
Hat man ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn man Leuten innere Vorgänge schildert, die gar nicht stattgefunden haben? Wozu will Habeck es plötzlich so perfekt haben?
Eine Inszenierung kann eine legitime Überzeichnung von Inhalten sein. Gelingt sie nicht, wird es schnell peinlich. Aber was, wenn sie erst gelingt, wie in Schleswig, und später in sich zusammenfällt? Dann landet man schnell bei der Logik der Peinlichkeiten um Annalena Baerbock nach ihrer Kandidatenkür.
Habeck wird nachgesagt, er könne überall frei reden. In Schleswig wirkt er so frei wie ein Comedian, der ein Bühnenprogramm um recycelte Pointen variiert und auf Resonanz hin anpasst. Das Publikum bekommt ein Best-of-Habeck und Habeck bekommt Applaus dafür. Vor dem Auftritt muss ein 30-sekündiges Video für eine Instagram-Kampagne fünf Mal neu gedreht werden, weil sich Habeck verrechnet, verhaspelt, verräuspert. Er, ist oft zu lesen, sei der einzige Politiker in Deutschland, der nicht wie einer spricht. Er ist ein Politiker, der manchmal nicht wie einer spricht, er bricht mit Sprechritualen, ist aber, nach fast 20 Jahren in der Politik, längst nicht frei von Floskeln und Routinen. Habeck sagt: „Ich wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert.“ Er sagt: „Umgekehrt wird ein Schuh draus.“ Schon vor zehn Jahren sagte er dem Reporter: „Es gibt eine permanente Grenze, die ich auch als Begrenzung spüre, nämlich rhetorisch überziehen zu müssen, flacher argumentieren zu müssen, als ich es eigentlich wollte. Das ist einer öffentlichen Erwartungshaltung geschuldet, der ich nicht immer widerstehen kann.“
Jemand, der einmal Fehler gemacht hat und in der Öffentlichkeit dafür geradestehen musste, hat möglicherweise eine größere Neigung zu Kontrolle und Perfektion. Natürlich ist es auch ein Problem, wenn sich die Dinge wiederholen, wenn man immer besser wird in dem, was man macht, und unweigerlich sich langweilt und denkt, aber nie sagen darf: Ist mir zu blöd. Das ist die Schizophrenie des Berufspolitikers, der ständig zu anderen Klientelen spricht und dies natürlich beim Sprechen berücksichtigt. Bei Habeck wirkt der Drang zu orchestrieren aber besonders widersprüchlich, weil er das Image des Naturbelassenen kultiviert. Bei akuter Unterforderung scheint er zeigen zu wollen, dass er mehr kann, dann wird ihm die Politik zu eng. Eitelkeit zeigt sich auch in Momenten, in denen er nicht gelebten Biografien nachspürt oder darauf pocht, dass seine Mehrfachbegabung wahrgenommen wird, wie bei einem Auftritt in der Büchersendung „Das Literarische Quartett“, wo seine apodiktischen Urteile fachfremd und unbeholfen wirken. Vielleicht ist es dieser Hang zum Rollenwechsel, der einige bei Habeck zögern lässt. Angst vor zu viel Eigensinn an der Spitze, vor dem ewigen Joschka, der sich nicht mehr einfangen lässt.
Glätten, was zu glätten ist
Habeck kann verblüffen und enttäuschen. Er kann ausschweifen, grün und ungrün reden, ackern, schlagfertig, theatralisch sein. Aber Habeck ist keine Lichtgestalt, und bei allem performativen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz wohl eher NDR als HBO. Die deutsche Politik ist keine Hochglanzveranstaltung, weil ihre Macher selten echte Stars sind, weil sie nicht jung sind oder nie jung waren, weil die Kommunikationserfordernisse längst zu groß geworden sind für eine Langstrecke fehlerloser Botschaften. Aber die Grünen sind stets bemüht und manchmal anmaßend in ihren Versuchen, zu glätten, was zu glätten ist.
In Deutschland ist es üblich, dass Zitate autorisiert werden. Gesprächspartner bekommen also die Möglichkeit, das Gesagte vor Veröffentlichung noch einmal zu prüfen, Irrtümer auszuräumen und kleinere Änderungen vorzunehmen. Die Grünen haben einen ungewöhnlich hohen Nachregulierbedarf entwickelt und instrumentalisieren diese Autorisierungspraxis vielleicht noch stärker als die anderen Parteien: Interviewantworten werden sinnentstellt, Botschaften ergänzt, unerwünschte Passagen ausgetreten, gelöscht.
Als vier Zitate Habecks, die in diesem Text vorkommen sollen, zur Freigabe an die Pressestelle gesendet werden, kommen sieben Zitate zurück. Darunter nicht bestellte Trivialitäten wie „Ohne mein Leben in Dänemark wäre ich nicht der Politiker, der ich bin“. Es scheint einen Grundwiderspruch zu geben zwischen dem akrobatischen Außenappeal der Selbstpräsentationsmaschine Habeck und der verklemmten Kampagne der Grünen. Die Marke Habeck ist der politische Abenteurer, sein Bühnengestus: Scheißegal, so rede ich. Die mit wolkigen Worten zugedeckte Habeck-Version der Pressestelle klingt, als wolle sie einen verzagten Gefühlsminister forcieren. Es ist gar nicht lange her, da musste Habeck nach dem Posten einiger Pferdebilder erkennen, dass der Versuch, einer Instagram-Tauglichkeit hinterher zu eifern, politisch ins Leere läuft. Die Strategen der Grünen sind da noch nicht so weit.
„Aus dem Hintergrund müsste Habeck schießen“
Habeck wird derweil in einem silbergrauen Elektrovan durch Deutschland gefahren, er spricht auf Marktplätzen in Limburg, Würzburg, Paderborn. In Offenbach geht ein Regenschauer runter, Habeck stellt sich an den Rand des überdachten Podiums und sagt: „Dann werde ich eben auch nass.“ In Schwerin erklärt er den Ostdeutschen, weshalb die Skepsis der Ostdeutschen gegenüber den Grünen im Osten so groß ist, und macht dies an der Sprache fest: Agrarwende, Verkehrswende, Energiewende, das sei vielleicht zu viel der Wende für jene, die sich als Wendeverlierer sehen.
Nach vier Wochen steht Habeck wieder vor der noch hoch stehenden, heißen Augustsonne auf dem Stadtfeld in Schleswig. Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der Grünen, sprach zum Wahlkampfauftakt von einer „Mördertour“, die jetzt zu einem Drittel geschafft ist. Habecks Fahrer liest 8050 gefahrene Kilometer vom Tacho ab, doch es geht irgendwie nicht voran. Während die roten und die schwarzen Balken in den Umfragen rauf und runter laufen, tut sich bei den Grünen kaum etwas.
„Aus dem Hintergrund müsste Habeck schießen“, ruft ein älterer Mann den jungen Freiwilligen beim Bühnenaufbau hinterher. Immer noch und immer wieder wollen die Leute wissen, warum denn nicht er Kanzlerkandidat geworden ist, ob da vielleicht doch noch was geht. Es geht aber nichts mehr, und so ist der Kampf um das Direktmandat zu Habecks kleiner Kandidatur geworden. Vor vier Jahren kamen die Grünen im Wahlkreis 1 nach Erststimmen auf 10 Prozent, die Kandidatin der Christdemokraten holte das Vierfache. Außerhalb von Friedrichshain-Kreuzberg haben die Grünen noch nie einen Wahlkreis auf Bundesebene direkt gewonnen. Es geht jetzt darum, einen Triumph herbeizuführen.
„Hier ist aber nicht alles nur Robert Habeck“, sagt Stefan Seidler und streckt die Arme über den Tisch seines Flensburger Büros. Nach 60 Jahren nimmt der Wählerverband der dänischen und der friesischen Minderheit wieder an einer Bundestagswahl teil und will, von der Fünfprozentklausel befreit, mindestens ein Mandat holen. SSW-Spitzenkandidat Seidler legt die Fingerspitzen aufeinander und macht ein freundliches Gesicht. Seine Mutter hat Habecks Söhne in der dänischen Schule unterrichtet, der Kreis der Minderheit ist klein. Habeck hatte Anfang der 2000er-Jahre selbst überlegt, in den SSW einzutreten, in vielen Fragen liegt man nah beieinander, eigentlich ein Duell der wechselseitigen Sympathie.
Umso mehr ärgert Habeck das Timing. Natürlich wäre es leichter gewesen, hier ohne die Dänen zu gewinnen. Kurz vor Weihnachten traf er sich mit den führenden Leuten der nach Mitgliedern drittgrößten Partei in Schleswig-Holstein, um eine gemeinsame Erststimmenkampagne für sich zu verhandeln. Doch daraus wurde nichts. Habeck klingt jetzt wieder verbissener, für ihn steht mehr auf dem Spiel als für Seidler. „Viele Leute wissen, dass auch ich in der Lage bin, Minderheiten zu vertreten. Ich nehme denen also auch Stimmen weg. Wer am Ende wem mehr wegnimmt, wird man sehen“, sagt Habeck in Schleswig. Stefan Seidler guckt jetzt noch freundlicher, macht eine Pause. Dann: „Was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist: Das Direktmandat treibt ihn wirklich um.“
Seine Politik ist jetzt eine des Müssens
Bei seinem zweiten Auftritt im Norden pariert Habeck gekonnt einige Impfgegner, die da rumlärmen. Er rankt seine Rede um Agrarwende, Verkehrswende, Energiewende, die Sache mit der Sonne, die Sache mit dem Wind. Nach dem Applaus zerstreut sich die Menge, ein Ruf noch, ein Selfie, Habeck hält still kurz, dann Nicken und Gehen, er grüßt ein letztes Mal mit der Faust und steigt etwas schwerfälliger als noch im Juli in den Innenraum seines silbergrauen Elektrovans.
„Ich kenne ihn, aber er kennt mich nicht“, hatte die Kreisvorsitzende Uta Bergfeld über ihr Verhältnis zu ihrem Parteichef gesagt. Sie sagte: „Ich weiß alles über ihn, aber er weiß nichts über mich.“ Es klang nicht geknickt, ihr war das einfach nur aufgefallen.
Bergfeld kam nach einer Initiative gegen Fracking zu den Grünen, als in der Nähe ihres Dorfes gebohrt werden sollte. „Wir sind in den Fight gegen Roberts Ministerium gegangen und haben das verhindern können, weil er auf uns zugegangen ist. Das hat mich überzeugt. Dass sich etwas verändern lässt, wenn die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen.“
Die Veränderung der Politik durch den Menschen dauert für gewöhnlich etwas länger als die Veränderung des Menschen durch die Politik. Habeck, der oft darüber nachdenkt, was Dinge mit ihm machen, tut viel, um auszusehen wie jemand, der immer noch macht, was er will. Aber natürlich ist er als angehender Bundesminister längst nicht mehr nur „der Robert“, als der er sich ankumpelnd vorstellt, wenn er für seine oder gemeinsame Sachen kurz Nahkontakt aufnimmt.
Was aber unentwegt aufleuchtet im Wahlkampf, ist sein Gespür für Stimmungen. Seine Fähigkeit, Menschen binnen kürzester Zeit aufzurütteln, mitzureißen, abzustoßen. Habeck demobilisiert nicht, er politisiert. Er, bereit auch mal aufzuprallen, ist der Körper vor dem Parteiprogramm, mit einer Körpersprache, die auch verstanden wird. Das unterscheidet ihn vom gegenwärtigen Kanzlerkandidatenfeld und macht ihn zum plausibelsten Angebot, das die Grünen zu bieten hätten.
Im Baerbock-Schlamassel machte sich Habeck als krisenkommunikativer Kopf der Partei unersetzbar. Er fand die richtigen und wichtigen Worte, als diese überfällig waren, als andere auswichen, schwankten, heillos schwafelten. Er hat dadurch neues Vertrauen gewonnen. Auch das dürfte nach dem Wahlsonntag noch eine Rolle spielen.
Wo man jetzt wohl stünde mit ihm? Bei den Grünen hört man im späten Bundestagswahlkampf Stimmen, die sagen, es sei vielleicht sogar ganz gut, dass der große Hype vorüber sei. Eine Regierung anzuführen wäre zu früh gekommen, die Partei könne dem noch nicht standhalten. Es sei eben besser, nachhaltig zu wachsen.
Habeck, der nichts lieber tun wollte, als dieser Republik als Kanzler zu dienen, lauert schon wieder. Sein Mobilisierungsmantra lautet krisenwärts: „Wir können nicht mehr nicht handeln, wir können nicht mehr nicht politisch sein.“ Seine Politik ist jetzt eine des Müssens. Aber vielleicht muss er nun erst einmal geduldig und ähnlich weitsichtig sein wie Angela Merkel, als sie Edmund Stoiber den Vortritt ließ. Im Jahr als Habeck auszog, um in einem Bahnhofslokal Kreisvorsitzender zu werden.
© Jasper Fabian Wenzel · Berliner Zeitung am Wochenende, 18./19. September 2021
SCHATTENMÄNNER
Saufen, Rauchen, Glücksspiel: Die Lobby-Industrie vertritt einen Lebensstil, der unserer Gesellschaft schadet. Was macht das mit den Verantwortlichen?
Die silberne E-Klasse kommt im Rheinauenpark zum Stehen. Blick auf das Siebengebirge, den Petersberg und eine Würstchenbude: Bonn, Atlantis der alten Bundesrepublik, hier hat Peter Spary Büro, Zuhause und Erinnerungen an ein Lobbyleben, das von Ludwig Erhards Kanzlerjahren bis in die Gegenwart reicht.
Spary hat sich schon zu Bonner Zeiten als exaltierter Offensivlobbyist nobilitiert und auch nach dem großen Umzug kurz vor der Jahrtausendwende rasch in Berlin einen Namen gemacht. Seine Offenheit wirkt manchmal derart überakzentuiert, dass man vermuten könnte, er habe vielleicht besonders viel zu verbergen.
Im dritten Berliner Hauptstadtjahrzehnt ist der Lobbyismus in Deutschland vielleicht so mächtig wie nie. Die einflussreichsten Unternehmen und Verbände haben sich um den Bundestag herum eine große Bühne gebaut. Aber es gibt auch Branchen und Spielarten des Lobbyismus, die sich überlebt haben, die nicht mehr recht passen wollen in ein fortschrittszugewandtes Land, das da sagt: Wie es ist, darf es nicht bleiben.
Peter Spary erzählt ganz unverstellt. Wie er Abgeordnete im Bundestag mit „guten Impulsen“ versorgt, wie es ihm gelingt, Lobbykongresse in Bundesministerien abzuhalten. Zur üblichen Praxis der Bezahlung bei Restaurantbesuchen sagt Spary, er könne „nicht erwarten, dass die Abgeordneten das Essen von ihren schmalen Diäten zahlen.“
Spary öffnet seine Brieftasche: „Dr. Dr. h.c. Peter Spary“ steht auf der Visitenkarte, ein Ehrendoktor, ein echter. Optisch erinnert Spary – klein, unbescheiden, helles Gemüt – an Norbert Blüm, den standhaften Arbeits- und Sozialminister, der als einziger alle fünf Amtszeiten in Kohls Kabinetten überdauerte. Spary, 81 Jahre alt, ist seit 1964 in der CDU. „Es war eine gewaltige Zeit, in die ich da hineingekommen bin. Unsere Mittelstandstruppe war so machtvoll damals, dass sie den Buchdrucker Karl Schmücker als Nachfolger Ludwig Erhards zum Wirtschaftsminister durchsetzen konnte. Mit Carsten Linnemann sind wir natürlich auch auf einem guten Weg.“
Spary konzentriert sich bei seiner Arbeit auf die konservativen Parteien. Der Volkswirt und frühere Hauptgeschäftsführer der Mittelstandsvereinigung der Union führte jahrelang die Geschäfte des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleitungen und vertritt heute eine Vielzahl von Firmen und Verbänden. Darunter den Verein zur Förderung der Wettbewerbswirtschaft, der Kontakte zwischen Lobbyisten und Politikern herstellt und in der Vergangenheit auch Beraterverträge zwischen Firmen und Politikern vermittelte. Aber auch für Brandschutz und Daunenfedern ist Spary zuständig, und nicht zuletzt für einige in Menschenrechtsfragen äußerst fragwürdige Regime in Asien und Westafrika.
Einmal gab sich Spary für einen Einspieler der „Heute Show“ vor dem Ostflügel des Reichstags als Lobbyist zu erkennen, ergab sich dem Klischee, lieferte guten Stoff und ließ selbst den Satiriker Ralf Kabelka staunen: Ein deutscher Lobbyist mit Humor, der sich nicht der Deutung entzieht. Am Ende des Beitrags fuhr eine Limousine mit blau-weiß-grünem Fähnchen vor, Spary war sich nicht sicher: „Könnte Usbekistan sein. Für die bin ich natürlich auch Lobbyist, da habe ich aber keine Visitenkarte dabei, ein Jammer!“
Spary greift abermals zur Brieftasche. Jetzt also die Visitenkarte der Deutsch-Usbekischen Gesellschaft. „Vicepresident“ steht unter seinem Namen. Spary ist gleich mehrfacher Inhaber solcher dekorierter Phantasieposten, hinter denen sich Lobbytätigkeiten für politisch zweifelhafte Volkswirtschaften verbergen. Bei der Frage nach der moralischen Schräglage solcher Engagements bleibt Spary eindeutig: „Einmal war ich als Wahlbeobachter in Usbekistan, aber nicht für die OSZE, sondern auf Empfehlung des usbekischen Botschafters. Business Class, gutes Essen, schönes Hotel.“ Er habe sich mit seinen Auftraggebern immer voll identifiziert.
Nachglanz der Bilder von einst
Spary hat eine rührende Freude am Schein, den er für nötig hält, ist unverborgen stolz auf seine Meriten, die sich über die vielen Lobbyjahre angesammelt haben, Verdienstkreuze, das Handwerkszeichen in Gold („das neiden einem natürlich manche“), auf Orden aus dem Senegal, auf seinen Presseausweis und die allseits begehrte Zugangsberechtigung aus Plastik, den Hausausweis des Bundestags.
Wir fahren zum Abschied einmal quer durch die ehemalige Bonner Männerrepublik, die Ludwig-Erhard-Allee dahin im silbernen Benz. Spary hat einen guten Schwung, man erfährt Erstaunliches:
„Links sehen Sie ein altes Gebäude der Polizeiverwaltung, da ist ein bisschen Asbest drin, deshalb steht es leer. Mich hätte das nicht gestört.“
„In Bonn und Berlin gibt es jeden Abend Empfänge. Die Abgeordneten freuen sich, wenn es den Alkohol am späten Abend umsonst gibt.“
„Ich verdiene etwas oberhalb der Besoldungsgruppe B 11, das ist auskömmlich.“
„Maike Kohl-Richter ist ein richtig feiner Kerl.“
Einerseits gibt sich Spary als Faktotum und betonter Hardliner, andererseits findet er die Tempo-30-Zonen der Grünen Oberbürgermeisterin in der Bonner Innenstadt heute gar nicht mehr so doof. Gemütliches Fahren durch Sparys Erinnerungsräume, Gedanken zur Bedeutung der Gastronomie als politischer Ort: „Die besseren Lokale in Bonn haben inzwischen mittags geschlossen, ein weiterer Beweis dafür, dass die Lobby hier nicht mehr so stark vertreten ist.“
Auch Bad Godesberg hat sich nicht gut entwickelt. Der einstige Diplomatenvorort ist heruntergekommen, Unkraut am Bungalow, Schwermut, Risse. Geht noch immer nicht spurlos vorüber an Spary, das unwiderrufliche Ende der Bonner Party. „Eine gewisse Sauerei“ sei das, sagt er vor dem inneren Nachglanz der Bilder von einst. Dann noch das alte Regierungsviertel – „hier war“, „man erahnt noch“, „wenn Sie genauer hinsehen“ –, Palais Schaumburg, Kanzleramt und Kohl forever.
Norbert Blüm hatte einst gesagt, im Internet kannst du kein Bier zusammen trinken. Darüber denke er auch im zweiten Jahr der Pandemie nicht anders, sagt Spary. Gleich nach der Bundestagswahl will er wieder zusammenkommen mit den Richtigen und den Wichtigen. Berlin! Er freue sich auf einen heißen Herbst.
Wohin beim Rauchen die Reise gehen kann
Man kann es bei Michael von Foerster versuchen. Der 54-Jährige ist Lobbyist für den Verband der deutschen Rauchtabakindustrie. „Old Economy“, sagt Foerster, Pfeifen, Feinschnitt, Zigarren, die Tabaklobby hat ihre Etage in Randlage, hinter dem Postblock des Bundesministeriums der Finanzen.
Wie man Tabaklobbyist wird? „Headhunter“, sagt Foerster und macht eine Faust. Er habe nach einem Engagement bei Bosch mehr ins Risiko gehen wollen. Also gut: Nach der Frage, wie man Interessen vertreten könne für ein Produkt, das süchtig macht und sogar tödlich sein kann, wechselt bei Foerster kaum die Stimmfarbe. Kennt er natürlich schon. Der höfliche Hauptgeschäftsführer antwortet schließlich so: „Ich sehe den Menschen in seiner Eigenverantwortung. Wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft. Jeder weiß, wohin beim Rauchen die Reise gehen kann.“
Das Bundesgesundheitsministerium schreibt: „Jährlich sterben in Deutschland über 127.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.“ Foerster hat den Hemdkragen offen, er sagt: „Natürlich weiß ich, dass wir grundsätzlich Gegenwind haben, aber mir widerstrebt es, dass wir ständig über Verbote und Einschränkungen reden bei einem legalen Produkt.“
Foerster und sein Verband sprechen beim Tabakkonsum nur mehr von Genuss. Da geht es um alles, da wird Foerster politisch: Wie wir eigentlich leben wollen. Mehr Freiheit, weniger Verbotskultur, weniger Bevormundung. Beim Versuch, die Wörter aufzumachen, um zu sehen, was drin ist, zeigt sich schnell, wie hier wirtschaftliche Interessen als gemeinwohlorientiert angestrichen werden. Förster sitzt vor einem Landschaftsbild mit Kuh und macht ein Gesicht, als sei mit seinem persönlichen Freiheitseifer alles gesagt über die Beweggründe der Tabakbranche.
Das autoerotische Hollywood-Image des Rauchens hat sich verbraucht. Werbeverbot, Steuern, Schmuggelbekämpfung – die Tabakwirtschaft hat es trotz Legalität immer schwerer, weshalb sich Politiker nur noch ungern mit ihr sehen lassen. Bitte lieber keine Bilder mehr mit Zigarette. Auch Michael von Foerster muss zugeben: „Es ist schwierig, heute noch einen Pfeifenraucher des Jahres aus der Politik zu finden.“
Freibier ohne Ende
Was sonst noch alles hinter dem Schwärmen der Lobbyisten für einen artgerechten Umgang mit Suchtmitteln steckt, davon erzählt Aurel von Lobbycontrol bei einem Rundgang durch das Regierungsviertel. Lobbycontrol ist ein gemeinnütziger Verein, der aufklärt über Machtstrukturen und Strategien der Einflussnahme, der antritt für mehr demokratische Kontrolle und Transparenz, gegen den Einfluss von Lobbyisten auf Gesetzestexte, unlautere Nebeneinkünfte und übergangslose Wechsel der Abgeordneten in die Wirtschaft. Das neue Lobbyregister, das vom Bundeskabinett noch vor der Sommerpause verabschiedet wurde, geht auch auf die jahrelange Arbeit von Lobbycontrol zurück.
Lobbyismus gilt als Vertretung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Interessen gegenüber der Politik. Als solche ist sie legitimer Bestandteil von Demokratie. Verbände, Unternehmen, Gewerkschaften oder NGOs versuchen auf Gesetzgebungsverfahren einzuwirken, in öffentlichen Anhörungen, zu denen Vertreter von Interessengruppen eingeladen werden, um Stellungnahmen abzugeben, aber auch abseits der Öffentlichkeit. Auch Lobbycontrol betreibt in diesem Sinne also Lobbyismus. „Problematisch ist aber“, sagt Aurel, „dass die Starken mehr Einfluss haben als die Schwachen. Die finanzielle Schräglage zwischen den großen und den kleinen Spielern nimmt zu.“
Gegenüber dem Bundespresseamt residiert der Deutsche Brauer-Bund, die Interessenvertretung der deutschen Brauereien und eine der ältesten Lobbyorganisationen in Deutschland. Wir stehen also bei der Frage, wie schaffen es die Vertreter der Droge Alkohol, Regulierungsvorhaben der Politik möglichst stark abzumildern? „Etwa indem man sie verharmlost“, sagt Aurel und nennt Publikationen oder Studien, die der Brauer-Bund selbst in Auftrag gibt (Kostprobe: „Bier ist reich an Vitaminen und arm an Kalorien, es regt den Stoffwechsel und die Durchblutung an, stärkt die Knochen und mindert das Herzinfarktrisiko“). „Noch besser aber“, sagt der Politikstudent, „sind schöne Fotos, am besten mit Spitzenpolitikern.“ Politiker und Bier, das geht, anders als Michael von Foersters Pfeife, noch immer. Jedes Jahr kürt der Lobbyverband einen Minister zum Botschafter des Bieres, zuletzt die Bundeslandwirtschaftsministern. In ihrer Taufe fürs Bierbotschafterinnenamt frohlockte Julia Klöckner, dass es doch immer besser sei, wenn die Unternehmen eigene Vorschläge machten, als wenn Politik regulieren müsse. Geschäftsführer des Brauer-Bundes ist Holger Eichele, der zuvor unter Ilse Aigner Sprecher des Bundesernährungsministeriums war. „Der Draht ins Haus dürfte weiterhin kurz sein“, sagt Aurel.
Auch der Brauer-Bund versucht Partikularinteressen der Brauereiwirtschaft als Gemeinwohl zu deklarieren. Der Tabaklobby nicht unähnlich schreibt der Verband auf seiner Homepage: „Die deutschen Brauer fördern ausschließlich den bewussten, verantwortungsvollen Genuss von Bier und lehnen jede Form des Missbrauchs von Alkohol strikt ab.“ Nach eigenen Angaben verfügt der Brauer-Bund über „ein Netzwerk mit Zugang und Akzeptanz bei Ministerien, Politik, Behörden, Wissenschaftlern, Presse und Meinungsmultiplikatoren sowie mit Branchen im vor- und nachgelagerten Bereich.“ Das zahlt sich aus. Deutschland gehört zu den wenigen Staaten in der EU, in denen noch für Alkohol geworben werden darf. Moderate Biersteuer, moderater Jugendschutz, moderat auch beim Konsum im öffentlichen Raum. Tabaklobbyist Foerster sagte anerkennend, der Brauer-Bund mache einen guten Job.
Spieler, komm rüber
Auch Thomas Knollmann ist redefreudig, aber clever selektiert. Auch Knollmann hat souveräne Antworten auf sämtliche Anwürfe parat. Auch Knollmanns Kampf richtet sich gegen die Regulierung durch die Politik. Er ist Sprecher des Dachverbands der Deutschen Automatenwirtschaft.
Wir erreichen Knollmann auf der Autobahn. Er will, dass legales Glücksspiel als „sicher“ und „sauber“ wahrgenommen wird. Der Kick am Automaten gehöre „in geordnete Bahnen“ gelenkt. Soll heißen: Echte Gefahr für die Gesellschaft gehe nicht von gemeldeten, legalen Spielstätten aus. Schlimmer seien die unkontrollierten Angebote, die sich seit Jahren in Großstädten ausbreiten, die Cafécasinos und Shisha-Bars, die „illegalen Hinterzimmer, wo gespielt wird“. Sie sind das Feindbild, für deren Bekämpfung Knollmann und sein Lobbyverband die Politik begeistern möchte, damit die Regulierungsvorhaben gegen die Automatenbranche aus dem Blick geraten. Dafür hat die Automatenwirtschaft lange in den Länderparlamenten lobbyiert und viel Geld an Parteien gespendet, ist mit Abgeordneten ins tiefste Neukölln gefahren, um die Botschaft einzubrennen: Hier liegt das Problem, es braucht ein größeres legales Angebot – und das sind wir.
Das Bundesgesundheitsministerium schreibt: „225.000 Menschen in Deutschland sind spielsüchtig und oft stark verschuldet. Im Suchthilfesystem stellen die Geldautomatenspieler die größte Gruppe der Betroffenen dar.“ Warum möchte die Glücksspiellobby das Leid derer übersehen, die sich nicht mehr selbst helfen können? Knollmann sagt, der Automat sei okay. Er sagt, Spielsüchtige gebe es so oder so. Sollen sie lieber wohlgeordnet und legal ihr Geld verlieren.
Wenn im Lobbyismus nichts mehr geht, geht es um Arbeitsplätze: Weil die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg den neuen Glücksspielstaatsvertrag, der auch den Spielhallenbetrieb seit dem 1. Juli reguliert, noch schärfer auslegt als der Bund, müssen im Südwesten Spielhallen schließen. Die Regierung ist dabei den Empfehlungen der Suchtexpertinnen und Suchtexperten gefolgt, nicht der Glücksspiellobby. Da hat der Südwestableger von Knollmanns Verband in Stuttgart seine Botschaft an den Landtag projiziert: „Liebe Landesregierung, 8.000 Arbeitsplätze werden vernichtet!“ Die Grünen-Abgeordnete Muhterem Aras nannte die Protestaktion einen Angriff auf die Würde des Hauses. Die Automatenwirtschaft habe „den Landtag für ihre wirtschaftlichen Interessen missbraucht.“
Von Buddha gibt es den Satz: „Ihr sollt nicht eure Laster verbergen, sondern eure Tugenden.“ Die Lobbyisten des Lasters machen es umgekehrt und wollen plausibilisieren, was eigentlich sinnwidrig ist. Es geht darum, eine Erkenntnis, die sich gesellschaftlich durchgesetzt hat, das eigentlich schon Zeitgemäße, noch ein wenig hinauszuzögern.
Er beobachte da schon eine déformation professionelle, erzählte der Lobbyist eines Interessenverbands für Süßwaren in Berlin über sich und seine Arbeit. Man müsse dafür gemacht sein, es auszuhalten, überwiegend auf Ablehnung zu stoßen. Das sei nicht immer schön, aber man härte auch ab mit der Zeit.
Ende der Nullerjahre wechselte mit Marianne Tritz eine ehemalige Umweltaktivistin und Bundestagsabgeordnete der Grünen überraschend als Lobbyistin zum Deutschen Zigarettenverband. Damals sagte sie in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung: „Wenn ich ehrlich bin und mich hier umschaue, dann habe ich das Gefühl, dass es mehrheitlich Männer sind, mit denen ich es zu tun habe.“ Tritz blieb nur kurz in der Branche.
Die Schattenmänner der Vereine und Verbände für Tabak oder Glücksspiel sind unter den Lobbyisten im politischen Zentrum Deutschlands eine Minderheit, die es zunehmend schwer hat mit ihren Anliegen durchzudringen. Was auch zeigt, dass im Gewimmel der Lobbys vielleicht doch mehr über Fortschritt und das Gelingen von Demokratie zu lernen ist als über ihr Scheitern.
© Jasper Fabian Wenzel · Berliner Zeitung am Wochenende, 17./18. Juli 2021
KNAUFTS WENDE
Nach einem Verkehrsunfall in der DDR deckt die Statssicherheit den Fahrer unter mysteriösen Umständen. Ein Junge bleibt schwerverletzt zurück. Später verkehren sich die Vorzeichen von Recht und Glück für alle Beteiligten. Rekonstruktion eines Falles, der die Seelenlage zweier Familien bis heute bestimmt.
Januar 1986, ein Wochenanfang. Bärbel Christ ist bei den Uhren. Sie hat sich ihre Hände eingecremt, die rissige Haut, die Wetterstation in Leinefelde meldet fünf Grad Celsius, etwas wärmer als die Tage zuvor. Der letzte Schnee ist am Wochenende geschmolzen, das Weiß ist wieder grau geworden.
Hans Madeheim ist auf der Durchfahrt. Für den Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb transportiert er Faserholz für die Spanplattenindustrie. Exportware, das meiste davon geht in den Westen. Sein Fahrzeug passiert den Kalk-Steinbruch in Kallmerode, auf einem kurvenlosen Abschnitt der Dingelstädter Straße nehmen Hans Madeheim und sein Beifahrer einen Schluck Kaffee aus den Deckeln ihrer Thermosflaschen. Sie blicken aus dem Fahrerhaus: Januarkarg liegen die Felder vor der Ortseinfahrt Leinefelde Süd.
Dominik Knauft, gerade aufgesprungen, läuft den Schulweg zurück nach Hause. Er hat eine Eins in Mathe, er möchte seinem Vater davon erzählen.
Bärbel Christ steht in der Uhrenwerkstatt ihres Schmuckladens und schaut durch die Kellerluke auf die Straße. Da steigt ein aufgeregter Mann aus einem Kleinbus, jemand anderes ruft um Hilfe. Bärbel Christ läuft aus dem Laden nach draußen.
Hans Madeheim und sein Beifahrer haben in ihrer Fahrerkabine nichts bemerkt. Ein Fahrschullehrer setzt dem Holztransport in seinem hellgelben Wartburg hinterher, stoppt ihn am Ortsausgang: „Sie haben dahinten gerade ein Kind überfahren.“
„Toter Winkel“, sagt der Beifahrer.
„Toter Winkel“, denkt Madeheim.
Der aufgeregte Mann fischt den Jungen von der Straße, trägt ihn über die beiden Stufen bis in den Schmuckladen. Dominik wird auf den warmen, rotgemusterten Teppich gelegt.
„Die Hose habe ich erst zu Weihnachten bekommen“, sagt er, „die dürfen sie mir nicht aufschneiden.“
Dominik wird beim Überqueren der Kreuzung erfasst und 25 Meter über die Straße geschleift. Die Stoßstange erwischt ihn am Kopf, die Hinterräder haben ihm beide Beine überfahren. Er hat innere Blutungen, einen Beckensprung, die Harnröhre ist abgerissen. Der Notarzt bringt Dominik in das Kreiskrankenhaus in Reifenstein, ein ehemaliges Zisterzienserkloster, weite Flure, hohe Decken, Dominik verliert das Bewusstsein.
Der Unfall, ihr Sohn
Es ist ruhig bei Familie Knauft, ein stiller, ein langsamer Abend. Hartmut Knauft sitzt in der Straßeneinfahrt in Sportkleidung auf einem Einrad und trainiert sein Gleichgewicht. Elisabeth Knauft kocht Espresso. Sie hat seit der Wende in ihrem Haus ein Kosmetikstudio, hinten über den Hof, Vorder- und Hintergarten sind sauber abgezirkelt.
Elisabeth Knauft faltet die Hände. Ein wenig Anspannung ist dabei. Vor allem wegen der Fotos, die gemacht werden, aber auch immer noch aufwühlend: der Unfall, ihr Sohn.
„Mein Mann lässt sich bestimmt gerne fotografieren“, sagt sie.
„Du bist doch extra noch beim Friseur gewesen, hast du gesagt“, sagt Hartmut Knauft nach absolvierter Einrad-Einheit. Heiterkeit. Nach fünf Minuten im Haus von Familie Knauft ist klar, dass es hier nicht bloß sehr ordentlich, sondern auch sehr herzlich zugeht.
„Als Dominik den Unfall hatte, habe ich noch als Hautärztin gearbeitet“, sagt Elisabeth Knauft. „Der Klinikleiter hat mich und meinen Mann ins Krankenhaus gefahren. Wir selbst haben uns erst nach dem Unfall einen gebrauchten Trabant gekauft.“
Die Volkspolizei hatte die Passanten, die Augenzeugen auf der Kreuzung, sofort vernommen. Die zu Protokoll gebrachten Aussagen sind einstimmig: Dominik hatte die Ampel bei grün überquert. Den Jungen traf keine Schuld.
Dies ist die erste offizielle Version der Geschichte, die Familie Knauft erreicht. „Gesehen haben wir Dominik erst am nächsten Tag“, sagt Elisabeth Knauft, „und da lag er intensiv. Wir wussten ja noch gar nicht, ob er wieder in Ordnung kommt.“
„Die Polizei hat Dominik direkt nach dem Aufwachen befragt und unsere Fragen abgewimmelt“, sagen die Knaufts. Wenige Tage später kam ein Brief der Volkspolizei, alle Aussagen seien zurückgezogen, kein Schadensersatz, alle weiteren Versuche zwecklos.
„Wir haben uns komplett ohnmächtig gefühlt damals“, sagt Elisabeth Knauft, man könne sich heute nur schwer in die Perfidität des Systems hineindenken. „Ich kann mir nur vorstellen, dass sie den Fahrer unter Druck gesetzt haben, dass er gezwungen wurde, IM zu werden. Oder er ist es vorher schon gewesen. Anders kann ich es mir heute nicht zusammenreimen.“
„Ich weiß noch, seine Oma hat damals aus dem Westen einen Walkman mitgebracht“, erzählt Hartmut Knauft. „Da hatten wir ihm so eine Kassette gegeben, wo mal was Lustiges drauf war. Dominik sagte, er könne die Kassette nicht hören, beim Lachen hatte er furchtbare Schmerzen.“
Die Urologische Abteilung in Reifenstein wird 1965 eröffnet. 1977 kommen die Intensivstation und die Abteilungen Anästhesie und Intensivmedizin dazu. Die Einrichtung, das ist Dominiks großes Glück, ist auf den Notfall gut vorbereitet.
Als Dominik aufwacht, hat er Schläuche im Bauch, die Beine sind komplett eingegipst. Irgendwann werden es weniger Schläuche. Dann gibt es eine neue OP und die Schläuche sind wieder da. Es dauert viele Wochen, bis die Ärzte sicher sind, dass er wieder auf die Beine kommt.
„Am Anfang wurde gesagt, ich würde nie wieder laufen können. Es hieß, ich würde immer diesen Katheter tragen müssen“, sagt Dominik. „Todesangst hatte ich keine. Ich hatte Angst vor bestimmten Tagen. Wenn wieder eine Operation anstand. Wenn Kontrastmittel gespritzt oder die Blasenwand durchstochen wurde.“
Dominik liegt mit älteren Männern zusammen, denen sie Gallensteine entfernt haben. Er hat die Tage für sich und seine Gedankenwelt. Schmerzen hinterlassen kleine Spuren. Doch er beschreibt die Zeit im Krankenhaus, wie sie ihm vorkam, vor allem als eine Zeit der ersten intensiven Selbstwahrnehmung.
„Man hat mir im Krankenhaus das Bett ans Fenster gerückt, und ich dachte, wenn ich diesen Ort jemals verlasse, will ich die ganze Welt sehen.“
Die Grenze, sein Leben
Am Abend des Unfalls steht Hans Madeheim mit einer Tafel Schokolade am Empfang des Krankenhauses. Er wird gebeten, zu warten – dann wird er gebeten, zu gehen. Dem Jungen gehe es zu schlecht.
Schwermütig kommt Hans Madeheim in sein Zuhause in Bollstedt an der Unstrut. Schwermütig ist ihm noch oft, wenn er mit seinem Beifahrer Siegfried Lehmann, genannt Seemann, über den Unfall und den Jungen aus Leinefelde spricht.
„Du hast ihn auch nicht gesehen, Seemann.“
„Ich habe ihn auch nicht gesehen, Hans.“
Er ist sein ganzes Leben nur gefahren, sagen die Kinder. Oft die Strecke hoch nach Leinefelde, jeden Tag Holz, entastet und entwipfelt, meistens aus dem Raum Mühlhausen und fast immer mit Passierschein durchs Grenzgebiet. Seit 1953 ist Hans Madeheim als Kraftfahrer tätig für den Forst. 1983 bekommt er eine Urkunde für 30 Jahre unfallfreies Fahren. Ein Mann, dem man vertrauen kann. Die Grenze war sein Leben.
Hans Madeheim muss den Unfall noch am Nachmittag mehrfach nachstellen. Sadismus der Volkspolizei. Es schüttelt ihn hinter dem Steuer, da liegt etwas in Trümmern in ihm. Es waren ja unglückliche Umstände. Das plumpe Fahrzeug, ein russischer Kamaz Lkw, Lizenzfahrzeug mit Riesenkraft, mit Atlaskran und Anhänger, die Ampel, die kurze Grünphase, der quicke Junge, peng.
Nach der Grenzöffnung kommen in Leinefelde die ersten Stasigeschichten ans Licht. Die Stärke der katholischen Kirche im Eichsfeld war dem Staatsapparat suspekt, so wurde bisweilen besonders heimtückisch vorgegangen. Dominik erzählt die Geschichte eines Leinefelder Lehrerehepaars, das sich gegenseitig über 25 Jahre hinweg bespitzelte. Staatssicherheitssadismus.
Die meisten lernten mit dem Überwachtwerden zu leben. Aus Selbstschutz. Oder als andere Form des Widerstands. Die Knaufts waren keine Dissidenten, eher still in ihrer Ablehnung staatlicher Bevormundung. Und durch den Unfall und die Reaktion des Staates logischerweise eingeschüchtert auch.
An der Teistunger Straße bei Worbis, dem Nachbarort von Leinefelde, liegt ein verlassener Grenzposten. Im Sommer 1991 spielt die Freundin von Dominiks bestem Freund Göran auf den Feldern. Den Grenzposten haben sie oft gesehen, sie nie hineingewagt, ihn wahrgenommen als dunklen Ort der Erwachsenenwelt. Aber einmal finden sie einen spaltweit aufgerissenen Einstieg durch den Keller und wühlen sich durch das ganze Haus. Da liegen ein paar Kisten und Ordner, verstaubte Artefakte. In einem schließlich finden sich, sauber dokumentiert, die Berichte über den Unfall auf der Kreuzung in Leinefelde fünf Jahre zuvor.
Dominik hält in den Händen, was seinen Eltern nach dem Unfall unzugänglich war. Ein schriftlicher Beweis und eine entscheidende Formulierung: „Die Ermittlungen der Deutschen Volkspolizei ergaben bis zum heutigen Zeitpunkt, daß der Kraftfahrer die alleinige Schuld an diesem Unfall trägt.“
Dominik nimmt sich einen Anwalt. Dann noch einen. Es kommt zu Schriftwechseln, immer wieder und immer wieder noch einmal neu. Eineinhalb Jahre vergehen, dann gibt es Geld. Ein Kompromiss im beschleunigten Verfahren, 5000 D-Mark Schmerzensgeld, zwölf Jahre nach den Schmerzen.
Dominik arbeitet heute als Journalist beim Fernsehen. Er ist ein heller Kopf, ein gut gelaunter junger Mann. Dem Fahrer des Lkw, mit dem er sich nie hatte auseinander setzen wollen, macht er keine Vorwürfe mehr. Er hat ihn deshalb auch nie angezeigt.
Heute ein Reisebüro
Wir spazieren noch einmal die Durchfahrtstraße von Leinefelde entlang, an Kreuzen und Kapellen vorbei: Das Katholische, das Konservative ist tief verwurzelt, das betont Autochthone, Leise, der kühle Stolz des Kleinstädtischen.
„Ich kann an Gott glauben, ich muss dafür nicht organisiert sein“, hatte Elisabeth Knauft am Küchentisch gesagt. Und es war ein Gespräch losgegangen über das katholische Eichsfeld und eine Welt des Schweigens. Dass der Glaube als Ideologieersatz auch Amnesie und falsche Läuterung bedeutet hat, davon ist sie überzeugt. Die Gottesdienste hatten für sie immer etwas Heuchlerisches, diese konstruierte Strenge, „als hätten einige da schweigend was absitzen wollen.“
Die Unfall-Kreuzung heute, fast 29 Jahre nach dem Unfall, die kleine Einkaufsstraße, bunte Fassaden, ein 99 Cent Laden mit dem Internet-Namen „Schnäppchen-Jäger24.de“, eine Café-Bäckerei ohne Namen, das Haus des ehemaligen Spielwarengeschäfts Leineweber, heute ein Reisebüro, das Blumenhaus Bause („Wir vermitteln, was Sie fühlen“) und, auf der anderen Seite der Kreuzung, die Motorradkneipe „Zum feuchten Eck“. Das Schmuckhaus Christ gibt es nicht mehr.
Bärbel Christ, die heute einmal im Monat zu Elisabeth Knauft ins Kosmetikstudio geht, um sich ihre Nägel machen zu lassen, deutet an, wie schwierig es auch heute ist, über damals zu reden, wie die Verschwiegenheit das Leben vieler Menschen hier immer noch prägt. Es herrsche eine Verunsicherung beim Sprechen über damals. „Darf man ja gar nicht erzählen“, sagt sie, „aber wir hatten schon auch Vorzüge durch unseren Laden, konnten etwa Schmuck gegen andere Wertgegenstände tauschen.“
Es ist schwer zu ermitteln, wovon Familie Madeheim profitiert hat. Hans Madeheim selbst kann nicht mehr sprechen. Er ist am 26. Januar 2013 verstorben. Sohn und Schwiegertochter erinnern sich zunächst gerne an den Vater. Detlev Madeheim beschreibt seinen Vater als ruhigen Mann. Besonnen, technisch und handwerklich begabt. „Einer, der aus allem etwas machen konnte, sich aber selbst aus wenig viel machte.“
Ein Jahr nach Beitritt der DDR zur Bundesrepublik wird der Staatliche Forstbetrieb aufgelöst. Mit 59 geht Hans Madeheim, weil es keine Arbeit mehr gibt für ihn, in den Vorruhestand. Den Jungen aus Leinefelde hat er nie gesehen.
Doch urplötzlich, als Fragen gefragt werden über früher, wollen die Madeheims nicht mehr reden. Der Ton wird barsch, das Gesprächsende ausweglos.
„Über die DDR werden überall nur falsche Dinge geschrieben“, sagt Madeheim, der sonst als Fußballschiedsrichter im Ort den Unparteiischen gibt. Auf den Hinweis, dass er ja nun noch einmal Gelegenheit habe, dies richtig zu stellen, erwidert er nur, es sei alles gesagt.
Bilder vom besseren Leben
Und vielleicht stimmt das auch. Sein Vater ist vom Staat geschützt worden. Die Familie Madeheim hat in der DDR ein gutes Leben gelebt. Sie sagen, sie haben sich wohl gefühlt. „Behütet“, sagen sie.
Familie Knauft ist am späten 9. November 1989 in einem Trabant Modell 601 über die Westgrenze gefahren und lernte eine Familie aus Göttingen kennen, mit der sie noch heute befreundet ist.
Familie Madeheim ist am 9. November nicht in den Westen gefahren. „So neugierig waren wir da nicht“, sagt Detlev Madeheim.
Der Unfallaugenblick in Leinefelde hat die Lebenslinien der Knaufts und der Madeheims bis in die Gegenwart hinein gegabelt, die Wende, sie wurde zur Angstumwendung für die Familien. Die Madeheims sehen die DDR als sorgenfreie Heimat, in der sie sich ideologisch und beruflich eingebettet fühlten. Fragen machen Angst. Von hinten und von vorne drückt und droht das Ungewisse. Die Knaufts sind heute dankbar, sagen zu können, was sie wollen, ihre Angst war mit der Wende fort.
Die Knaufts haben damals nicht die Freiheit gewählt oder das Neue Forum oder sich selbst, sondern Helmut Kohl und die Bilder vom besseren Leben.
„Vielleicht waren es zu viele Träume auf einmal, die plötzlich in Erfüllung gingen“, hatte Dominik Knauft gesagt, beim Sprechen über die Nachwendezeit. Er sagte: „Ende der Neunziger war mein Interesse am Westen erloschen. Als der Osten wieder spannend wurde.“
© Jasper Fabian Wenzel · Krautreporter 13. März 2015
DER HIRNPROFI
Johannes Mallow ist Gedächtnissportler. 2012 wurde er Weltmeister. Vergangenes Jahr hat er in fünf Minuten 1.080 Binärzahlen memoriert. Was taugt der Mensch als Datenvirtuose?
Kreuz-Vier, Kreuz-Dame sind ein Radio. Kreuz-Fünf, Kreuz-Drei sind Chip und Chap. Da ist Batman, da ein Taucher. Und hier: ein Saunaaufguss. Wie bitte was? Der Fahrstuhl sei wieder mal kaputt, Café gehe nicht, ich solle doch einfach gleich in seine Wohnung kommen, sagt Johannes Mallow. Für mich sind Treppen kein Problem, aber für Mallow, der seit drei Jahren wegen Muskelschwunds im Rollstuhl sitzt.
Das Haus ist ein heller Neubau in der Altstadt von Magdeburg. Unten gelb und blau ein Supermarkt, und da oben, im fünften Stock, das Superhirn, Johannes Mallow, 33, Gedächtnissportler, einer der weltschnellsten im Memorieren größerer Datenmengen.
Vor sich liegen hat Mallow zwei Kartenspiele. Zweimal 52 Motive. Ein Deck will er sich jetzt einprägen. Dazu übersetzt er Kombinationen der Karten in Bilder, um sich diese schneller einprägen zu können: Radio, Batman, Taucher, von der Karte zum Bild kommen und wieder zurück. Das Deck decodieren. Alles klar.
Mallow haut auf die Stoppuhr. Er schaut die Karten durch, haut auf die Stoppuhr – 38:40 Sekunden steht da. „Eine okaye Zeit“, sagt er, „schnell, aber nicht sehr schnell.“ Jetzt nimmt Mallow das zweite Kartendeck und versucht, es in die Reihenfolge des eben durchgesehenen ersten Blattes zu bringen. Fünf Minuten Zeit hätte er dafür normalerweise, also während eines Wettkampfs, also im Ernstfall. Jetzt, wo ihm der Reporter einen halben Meter entfernt gegenübersitzt, kritzelt, atmet, guckt, braucht Mallow etwas länger, sechs Minuten, dann hat er es geschafft. Komplett richtig alles.
Normalität ist eher schlecht
„Das war jetzt ein Weg in meiner alten Heimatstadt Rathenow, den ich entlang gegangen bin“, sagt Mallow. „Da gibt es ein Verkehrsschild, daran habe ich ein großes Herz gehängt. Und dann gehe ich zum nächsten Punkt, da steht ein Baum. Dann kommt eine Gummipuppe. Dann die Teletubbies. Durch das Koppeln dieser Bilder entwerfe ich Geschichten, mit deren Hilfe ich mir die Reihenfolge von Kartendecks immer wieder neu merken kann. Skurrile Bilder funktionieren am besten, Normalität ist eher schlecht.“
Was Mallow da erklärt, nennt sich Loci-Methode, das Assoziieren von Dingen und Orten: „Um mir Einkäufe einzuprägen, könnte ich in Gedanken eine Route durch meine Wohnung laufen, Eier an die Tür schmeißen, Brot ins Regal legen, auf Bananen ausrutschen. Je origineller die Geschichte, umso besser kann ich sie behalten.“
Für kompliziertere Aufgaben hat er größere Routen programmiert. Auf einigen kann Mallow mehrere tausend Bilder memorieren und wieder abrufen, in Informationen zerlegen. Mit außerordentlichen mentalen Qualitäten habe das erst mal gar nichts zu tun, alles Training, sagt er.
Es gab da, Anfang der Nullerjahre, einen Fernsehmoment: Verona Pooth, damals noch den gut klingenden Namen Feldbusch hintendran, hatte sich in Günther Jauchs „Grips-Show“ mit Hilfe eines Gedächtnistrainers imageverzerrend eine 20-stellige Zahl gemerkt. „Wenn die das kann, kann ich das auch, dachte ich“, sagt Mallow. „Sechs Jahre später war ich Deutscher Meister.“
Experte im Vernichten von Inhalten
„Beim Gedächtnissport sind Trainingsfortschritte messbar wie beim Laufen oder Gewichte heben“, erklärt Mallow. Die Leistungen verbessern sich durch regelmäßiges Üben, das Hirn entwickelt sich konstitutiv.
Den Gedächtnissport könnte man natürlich auch sehen als Auflehnung gegen die steigende Auslagerung von Erinnerungen in digitale Archive; ein Widerstand gegen die Tatsache, dass in uns heute vor allem gefördert und gefordert wird, was mit Geräten kompatibel ist. Und interessant ist doch, dass bei aller Mehrverarbeitung an Information, der Überforderung durch Echtzeitkommunikation und Vernetzungsstress, viele visuelle Bereiche des Gehirns eher unterfordert werden.
Die wesentliche Qualität der Topleute im Gedächtnissport ist weniger die Erinnerungsbegabung als die Fähigkeit, gerade gespeicherte Informationen schnellstmöglich wieder von der Festplatte runter zu bekommen. Um neu loslegen zu können mit einer neuen Merkaufgabe, der nächsten und übernächsten Disziplin.
Die New Yorker Psychologin Betsy Sparrow legte 2011 eine Studie vor, wonach das Gehirn dazu tendiert, nicht Information an sich zu speichern, sondern den Ort der Information. Entscheidend ist demnach eine gesteigerte Aktivierung der Strukturen des Hippocampus, Erinnerungen visualisieren zu können. Der Hippocampus wird in den Neurowissenschaften gemeinhin als Erinnerungsgenerator verstanden, spielt aber auch für Emotionen eine wichtige Rolle.
„Deshalb funktionieren die skurrilen Bilder und die Routenplätze vertrauter Orte merkbar am besten“, sagt Johannes Mallow. „Wenn ich auf meiner Route an einen leeren Platz komme, kann das ein Problem werden. Dann manipuliere ich, pflanze dort virtuell einen Baum und platziere meine Gedankenbilder dort. Funktioniert besser.“
Es geht Mallow darum, seine Methoden zu optimieren. Er führt Tagebuch, Erinnerungshefte, notiert sich, was geholfen hat. Hinweise für später.
Nach dem Besuch wird sich Mallow intensiv auf ein Turnier in den USA vorbereiten. Er hat ein Ticket nach San Diego gebucht, wo in ein paar Tagen ein Gedächtniswettbewerb stattfindet, der seiner kleinen, internationalen Community etwas mehr Aufmerksamkeit verschaffen soll. Der Sieger erhält 20.000 US-Dollar. „Auch nicht schlecht“, sagt Mallow. Er wird gleich, wie jeden Tag, eine halbe Stunde üben, seine Routen gedanklich ablaufen, vielleicht noch ein paar Mal die Karten durchgehen.
Jeder hat andere Rituale
Das Dart Neuroscience Convention Center in San Diego. Die Teilnehmer des Extreme Memory Tournaments (XMT) sind im Merkmodus. Tragen Schallschutzkopfhörer. Pressen die Finger ins Gesicht, machen mit den Fingern in den Haaren rum oder sitzen einfach ganz still da. Jeder konzentriert sich anders. Irritationen minimieren, da hat jeder andere Rituale.
Augenbinde
Augen schließen
Energydrink
Zigarettchen
Barfuß oder
Turnschuhe
Kopfhörer oder
Kopfbedeckung
Schokoladenkekse
Kaugummi
„Rituale sind immer gut“, sagt Mallow. Nur plötzlich aufs Klo müssen, ist gar nicht gut. Das war ihm 2013 bei den Gedächtnissport-Weltmeisterschaften in London passiert. Ausgerechnet ihm, Titelverteidiger, Favorit. Mallow wurde am Ende Zweiter, hinter dem Schweden Jonas von Essen.
„Normalerweise sind solche Wettbewerbe ziemlich langweilig fürs Publikum“, sagt Extreme-Memory-Veranstalter Nelson Dellis, der amerikanische Gedächtnischampion. Dellis brachte den Pharmakonzern Dart NeuroScience und die Washington University in St. Louis zusammen, die Veranstaltung zu sponsern. Dadurch ließ sich ein aufwendiges Programm für Live-Übertragungen auf Leinwänden und im Internet programmieren.
„Wir wollten es mal ein bisschen zuschauerfreundlicher machen. Finde, das ist uns ganz gut gelungen. Die nächste Gedächtnis-WM ist in China. Mal sehen, ob die das genauso gut hinbekommen.“ Das Klassenfeind-Bashing gibt es gratis dazu. Aber tatsächlich: Der Reporter kann Johannes Mallow von Berlin aus ganz komfortabel zusehen, die Live-Übertragung funktioniert tadellos. Und Spannung kommt auch auf. Als Johannes Mallow im Halbfinale gegen Weltmeister Jonas von Essen einen 0:3-Rückstand aufholt und ins Finale einzieht, hört man zum ersten Mal einen die Übertragung verzerrenden Applaus aufbranden.
Neben dem Kartenspiel, das es sich in fünf Minuten einzuprägen gilt, gibt es beim Gedächtniswettkampf in San Diego drei weitere Disziplinen: Nummern – eine Zahlenreihe auswendig lernen. Wörter – wobei in drei Minuten 50 Begriffe sich gemerkt und an der richtigen Stelle in ein Diagramm eingetragen werden müssen. Und schließlich müssen Namen Gesichtern zugeordnet werden.
„Namen liegen mir nicht so“, sagt Mallow. Dafür liegen ihm Zahlen. 1.080 Binärzahlen hat er sich vergangenes Jahr in fünf Minuten eingeprägt. Weltrekord. Mallow nutzt dabei das so genannte Mastersystem. Hierbei werden die Ziffern 0 bis 9 bestimmten Konsonanten zugeordnet. Die 2 steht beispielsweise für ‚n’, weil das ‚n’ zwei Beine hat. Im nächsten Schritt gilt es wieder zu kombinieren, sich ein eigenes Buchstaben-Ziffern-System auszudenken. „Die Zahl 22 kann man sich mit dem Wort Nonne merken“, sagt Mallow. „Diese Wörter werden dann wieder assoziativ verwendet, um mit ihnen eine Geschichte zu erzählen. Wenn man die Bilder verinnerlicht hat, ist es wirklich einfach, sich gleich 50 Kontonummern auf einmal zu merken.“
Auch diesmal wird Mallow zweiter. Simon Reinhard, ein junger Rechtsanwalt aus München, alter Kontrahent und ein guter Freund Mallows, ist an diesem Tag besser und gewinnt den Scheck über 20.000 US-Dollar. Immerhin bleibt Mallow Nummer eins der Weltrangliste.
Paar Ziffern mehr, paar Sekunden weniger
Ein paar Wochen vor San Diego sitzt Johannes Mallow vor etwa 50 Zuhörern in einem Vorlesungssaal der Fachhochschule Magdeburg in Stendal und erzählt von seinen Gedächtnistechniken.
„Kann eigentlich jeder“, sagt Mallow wieder einmal, aber hier wirkt er wie ein Zauberer.
Das Publikum in Stendal ist während der Vorlesung überwältigt, baff. „Immer wieder eine Freude zu sehen, wie man die Leute mit diesen Techniken überraschen kann“, sagt Mallow. Als die Zuhörer später den Saal verlassen, ist der Satz der Stunde: „Das will ich jetzt auch mal versuchen.“
„Die Leistungssteigerung, die am Anfang natürlich ungleich größer ist, motiviert enorm. Später sind die Fortschritte marginal, da kommt es dann, wie beim Hundertmeterläufer, auf die Tagesform an“, sagt Mallow. „Wenn man sich unter Druck mit den Besten in den Wettbewerben misst natürlich umso mehr.“
Es gibt ihm einen Kick, wie er sagt, die eigenen Grenzen zu verschieben. Ein paar Ziffern mehr, ein paar Sekunden weniger. Mallows nächtes Ziel ist es, den Gedächtnissport bekannter zu machen. Dafür geht er, ganz Verona Pooth, gezielt in Fernsehshows. Planetopia. Lanz. Unter uns. Ist auch da mittlerweile Profi.
Gedächtnistraining führe nicht dazu, dass man rascher denke oder nichts mehr vergesse. „Aber das Erfinden verrückter Geschichten im Kopf macht gedanklich beweglicher“, sagt Mallow. „Man könnte auch sagen, es macht einen lockerer.“
© Jasper Fabian Wenzel · Krautreporter, 18. Dezember 2015
IMMER NOCH STURM
Mike Drechsel sagt wenig, aber nicht nichts. Er hätte ein zweiter Michael Ballack werden können, doch er blieb im Harz und spielt heute in der Kreisliga. Vom vagen Glück, einen Schritt zurück zu tun – ein Nachwendeporträt.
Mach mal Sonne, aber nicht zu doll“, hatten sie gesagt. Und die Sonne knallt auf den Asphalt, und die Fußballschuhe der Männer klackern wie einhundert Stilettos. Die Kreisligamannschaft TSV Eintracht Wulften kommt von einem Spaziergang zurück auf das Vereinsgelände.
Dieses sonnenbeschienene Wulften also. Wulften am Harz. Hier räumt Mike Drechsel mit der Sohle einen Kieselstein zur Seite, im Vereinsheim gibt es Käseplatte, Wurstplatte und Brötchen, Drechsels Töchter laufen über den Rasen, die Zeit, die Zeit.
„Die Mannschaft hat am Vormittag bisschen trainiert“, sagt Trainer Stephan Strüber, „paar Pässe, Ballarbeit, kleines Spielchen, das ist die Lage.“ Es sind zwei Stunden bis zum letzten Spieltag, heute geht’s drum: um die Meisterschaft, den Aufstieg und um die Meisterfeier natürlich.
Wulften ist eine Fahrstuhlmannschaft. Dreimal ging es runter in den letzten neun Jahren, jetzt will der Klub das vierte Mal rauf. „Ruff“, sagt Stephan Strüber.
Mike Drechsel will einen Sommertag, der später als Foto im Vereinsheim hängt. Er spricht mit gesenktem Kopf, trägt die einfachste Brille der Welt, lächelt, hat einen Hang zum Unprätentiösen, ist gleichzeitig offen und verschlossen.
„Der talentierteste Stürmer, den der Harz je hatte“, sagt einer, der im gelben Gras seinen Klappstuhl aufgebaut hat. Der Zuschauer mit dem Klappstuhl macht eine Kopfbewegung rüber zu den Umkleidekabinen, zu den Männern mit den roten Trikots, die da warten, einklatschen, rummännern. Erinnerungsfetzen am Spielfeldrand: Mike Drechsel, der talentierteste Stürmer, eine Lichtfigur im Geschichtenraum Harz, der daliegt im Schatten des morschen Ost-Fußballs, der auch deshalb ein großer Anachronismus ist. Der Harz war immer ohne Profitum, ein Amateurfußballgebirge.
Mike Drechsel, geboren 1978, verbringt seine Kindheit in der Harzstadt Blankenburg, DDR, zwölf Kilometer bis zur Westgrenze. Seine Eltern arbeiten bei der NVA, untere Ebene, sie kocht in der Kantine, er hat einen einfachen Bürojob.
Mit fünf fängt Drechsel mit dem Fußball an. Erst ist er Torwart, weil er aber immer wieder nach vorne rennt, macht ihn der Trainer zum Stürmer. „Man muss wissen, wo man hinwill“, sagt Drechsel.
Nach der Wende, Anfang der Neunziger, spielt er in der Landesauswahl, trainiert fünfmal die Woche, fährt zu DFB-Lehrgängen nach Duisburg und Bad Honnef, er trifft Berti Vogts und trägt die Mannschaftskleidung der Nationalmannschaft.
Drechsel bekommt vom Hamburger SV einen Fördervertrag angeboten.
Für die U16-Auswahl macht er gegen Australien sein erstes Länderspiel.
Im Magazin „Kicker“ steht Drechsel zusammen mit den späteren Bundesliga-Torhütern Timo Hildebrand und Raphael Schäfer im vorläufigen Kader für die Junioren-EM in Belgien. Dann, er ist 15, passiert ihm die erste schwere Knieverletzung.
Es folgen Läsionen in schlecht dosierter Häufigkeit. Die erste Chance ist verrauscht. Aus dem Vertrag mit dem HSV wird nichts, es geht im Osten weiter.
Visitenkarten
Als Drechsel mit den A-Junioren seines Heimatvereins Blankenburger FV in die Regionalliga aufsteigt, kann der Verein den Etat nicht aufbringen. Er wechselt zum großen Nachbarn, dem es gar nicht gut geht. In der viertklassigen Oberliga ist der DDR-Traditionsverein 1. FC Magdeburg nur mittlerer Durchschnitt, etwa 600 Zuschauer gehen noch hin in eine fast tote Arena. Ein Fan-Albtraum. Die Leute, einigermaßen verzweifelt, schauen jetzt Boxen oder Handball.
Für Drechsel aber scheint es der richtige Augenblick, er spielt für die A-Jugend und beide Herrenmannschaften und steigt mit allen Teams auf.
„Drei Meisterfeiern“, sagt Drechsel.
Er unterschreibt einen Dreijahresvertrag, bis ins Jahr 2000. Das sieht gut aus und klingt gut und weit weg.
Ein Fußballheld von einst, der DDR-Rekordnationalspieler Joachim Streich, betreut das Team. Drechsel liegt neben dem Handballpunk Stefan Kretzschmar auf der Massagebank, hart und fröhlich, mit einer Ahnung wunderbarer Möglichkeiten. Noch immer geht der Weg junger Talente über die größeren Ostklubs in den Westen. 1997 ist Drechsels zweite Chance.
Es ist das Spieljahr, in dem der 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger die Deutsche Meisterschaft gewinnt. Michael Ballack, ein junges Talent aus Karl-Marx-Stadt, macht seine ersten Bundesligaspiele. Es ist das Jahr von Otto Rehhagel, von Schnurrbartstürmer Olaf Marschall und Giovanni Trapattonis Pressekonferenz beim FC Bayern München.
Der FC Bayern hätte Drechsels Geschichte werden können. Mit seinem Jugendverein fährt er kurz nach der Wende gen München auf seine erste Reise in den Westen. In einem Testspiel gegen den Bayern-Nachwuchs schießt Drechsel vier Tore. Eine schöne Visitenkarte für später.
Später, Sommer 1997, der FC Bayern München kommt für ein Testspiel nach Magdeburg. 25.000 Zuschauer sind ins Ernst-Grube-Stadion gekommen, für den gestürzten Ostverein soll es ein Spiel werden, das aus der Düsternis weißt.
Drechsel steht in der Startelf. Er hat seine erste Autogrammkarte bekommen. Im Fanshop hängt sein Trikot mit der Nummer 20. Die Fans hoffen, dass der 18-Jährige den Klub in die 2. Bundesliga schießt. Sie feiern ihn, weil er Kontakt sucht zu den Anhängern, weil er sich locker und gerne mit ihnen umgibt. Sie nennen ihn „Heiland“ und „Ronaldo“, und auf der Autogrammkarte sieht er tatsächlich ein bisschen aus wie der brasilianische Weltstar.
Als die Magdeburger Spieler sich aufwärmen, steht Drechsel noch immer bei den Fans, stolz und mit Filzstift.
Der Magdeburger Trainer und Manager Hans-Dieter Schmidt, ein Mann aus dem Westen, sieht so was nicht gern. Ronaldo darf nicht spielen, stattdessen macht der echte Brasilianer Giovane Elber sein erstes Tor für die Bayern, und München gewinnt 2:1.
Die ersten Zeitlupen
Später, in den Nullerjahren, war Hans-Dieter Schmidt Trainer im Iran, in Ghana, Ägypten und Saudi-Arabien. Magdeburg blieb sein einziger Job in Ostdeutschland. Jetzt liegt er, nach einem Unfall auf einer Afrikareise, im Krankenhaus. Er fühlt sich etwas schwach, an Drechsel erinnert er sich gut.
„Er war ein kleiner Spieler“, sagt Schmidt, „aber er hat mit Tempo und Artistik und einer sensationellen Torgefahr auf sich aufmerksam gemacht. Wir hatten ja auch einen Marcel Maltritz, der später für den HSV und für Wolfsburg in der Bundesliga spielte, aber für mich war Mike Drechsel unter unseren jüngeren Spielern der talentierteste. Einer der besten im Osten damals.“
Am 6. Spieltag, in Zehlendorf, wird Drechsel nach der Halbzeitpause eingewechselt. Es steht 0:2. Dann gibt es Elfmeter für Magdeburg, Kapitän Frank Lieberam verwandelt. Bei seiner ersten Ballberührung köpft Drechsel den Ausgleich, dann das 3:2 – wieder Drechsel. In der 70. Spielminute schafft Zehlendorf das 3:3, und eigentlich ist das Spiel schon zu Ende, als Drechsel in der Nachspielzeit wieder trifft mit dem Kopf. Drei Tore in seinem ersten Saisonspiel, Siegtore, die am Abend in der MDR-Sportsendung wiederholt werden. Es sind Drechsels erste Zeitlupen.
Drechsel ist 16, als er nach Magdeburg zieht, weg von den Eltern. Der Verein zahlt ihm eine Wohnung, besorgt ihm einen Ausbildungsplatz. Um 6 Uhr morgens ist Arbeitsbeginn, Training um 12 Uhr und hinterher wird weitergearbeitet. Am Abend dann das zweite Training, die Mannschaftsbesprechung, danach Mannschaftsessen in einem Hotel.
Drechsel wohnt auf der anderen Seite der Stadt, am nächsten Morgen geht es um 6 Uhr weiter, er fährt nicht oft zum Mannschaftsessen. Er fühlt sich allein gelassen in diesem Backstagebereich des Ostfußballs. Es ist eine brüchige, eine kalte Atmosphäre, die Drechsel beschreibt, wenn er vom Magdeburg der Neunziger spricht.
Hinter dem Stadion, am Trainingsgelände, liegt ein Kasino. Manchmal geht Drechsel mit einigen Teamkollegen hin, und manchmal gehen sie zum Boxen. Man ist für Henry Maske, den Gentleman, oder man ist für die härtere Straßenboxerfigur Graciano „Rocky“ Rocchigiani, den Antihelden, der sich, so die Geschichte, hart nach oben arbeiten musste, dem man nichts geschenkt hat, der nicht vergessen hat, wo er herkommt. Drechsel ist für „Rocky“.
Nach seinen Toren gegen Zehlendorf läuft bei Drechsel nicht mehr viel. Wieder das Knie. Und er hat auch Gegner unter den Mitspielern.
„Bestimmte Leute haben versucht, mich einzuschüchtern. Ich habe immer gesagt: Was soll das, wir sind eine Mannschaft, aber es hörte nicht auf. Einmal habe ich mich im Training revanchiert. Es gab eine Rangelei. Und irgendwie habe ich ihn dann wohl im Gesicht getroffen“, sagt Drechsel und lächelt die Geschichte weg.
Davon, dass er Drechsel nicht genügend gefördert hätte, will Hans-Dieter Schmidt heute nichts wissen.
„Das ist Quatsch. Er war sehr eigenwillig, ungestüm bisweilen. Er hätte es, nach seiner rebellischen Phase, bei einem anderen Verein probieren sollen. Der Osten ist Fußballbrachland, in Magdeburg war der Existenzdruck unter den Spielern ziemlich hoch. Dort war damals nicht viel zu machen. Ein Verein braucht Geld, um gestalten und Perspektiven bieten zu können. Im Osten gibt es keinen, der Geld hat.“
Heiland Drechsel, „der Knipser“, wie sie ihn später etwas schlichter nennen werden, ist zum ersten Mal in der Defensive. Aber er hat noch immer das Selbstbewusstsein der Schulterklopfer, das Wissen um seine Unentbehrlichkeit in der Vergangenheit. Hat er nicht jahrelang Leistung gezeigt? War das in der Jugendzeit Geleistete alles für den Müll, Bewerbung, Praktikum, Lehrgeld? Drechsel ist genervt. „Ich hatte die Schnauze voll“, sagt er.
Nach seiner Suspendierung hat Drechsel noch zweieinhalb Jahre Vertrag. Ein Bekannter hilft ihm bei der Annullierung, er leistet seinen Wehrdienst. Erst hinterher erfährt er: Es hatten Angebote für ihn vorgelegen. Von Hertha BSC Berlin verlangte Hans-Dieter Schmidt damals 350.000 Mark für einen Transfer. Im Amateurbereich eine Menge Schotter, Berlin winkte ab.
„Schmidt wollte Kasse machen, sonst nichts“, sagt Drechsel. „Das Geschäftsmodell war damals, Jugendspieler hochzuziehen und schnell für viel Geld anderswohin zu transferieren. Wir jungen Spieler mussten permanent zu irgendwelchen Probetrainings. Für die Entwicklung einzelner Leute hat sich der Verein nicht interessiert. Es wurde nicht viel gesprochen.“
Drechsel fühlt sich ein bisschen betrogen, er gibt sich Mühe zu überzeugen, dass ihn dies nicht mehr berührt. Hans-Dieter Schmidt sagt, er habe versucht, den Verein am Leben zu halten.
„Das war meine Aufgabe. Ohne Spielerverkäufe hätte sich noch so mancher Ostklub verabschieden müssen. Verkaufen war der Überlebensdeal.“
Ein Systemfehler, sagt Schmidt. Eine Scheiße, sagt Drechsel.
Fußballeinheit dort und hier
In den ersten fünf Jahren nach der Wende wechselten 150 Spieler, die zuvor DDR-Oberliga gespielt hatten, zu Westklubs in die 1. oder 2. Bundesliga. Hinzu kamen abgeworbene Jugendspieler von den ehemaligen Spitzenklubs, aus Berlin, Dresden, Leipzig, Rostock und Magdeburg, von denen viele noch Profis werden sollten. Darunter Michael Ballack, der in Chemnitz „kleiner Kaiser“ genannt wurde, der mit einer akribischen Karriereplanung zum Weltstar wurde, der Glück hatte, dass Chemnitz Mitte der Neunziger einen Ballack-Augenblick lang Profifußball spielte.
Das Wendejahr war die große Zeit des Fußballmanagers Reiner Calmund, der als Erster mit superscharfem Geschäftssinn seine Einkaufstour durch den Osten machte. Calmund warb Talente ab, schaffte große Transfers: Als erster Spieler der DDR-Oberliga wechselte Andreas Thom im Januar 1990 für 2,5 Millionen D-Mark vom BFC Dynamo zu Bayer Leverkusen in die Bundesliga. Kurz darauf holte Calmund auch Ulf Kirsten, den Mittelstürmer und Nationalspieler, von Dynamo Dresden nach Leverkusen. „Kirsten war ein ähnlicher Spielertyp wie ich“, sagt Drechsel, dann lässt ihn der große Vergleich kurz verstummen.
Nur zwei Ostklubs aus der DDR-Oberliga durften sich für die Bundesliga qualifizieren, die allerdings für eine Spielzeit von 18 auf 20 Teams aufgestockt wurde. Keine Verluste westseits also. Sechs weitere DDR-Oberligisten durften in die 2. Bundesliga, die man ebenfalls für eine Saison vergrößerte. Die restlichen Vereine sahen sich fortan anderswo. Unten.
Durch den Ausverkauf ihrer wichtigsten Spieler hatten die Ostklubs Geld eingenommen, Stigma und Qualitätsverlust, Reputation und Korruption aber machten sie chancenlos, alle Versuche, auf Dauer mit den Westvereinen mitzuhalten, scheiterten.
20 Jahre nach der Fußballeinheit bleibt ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Der DFB hat bei der Eingliederung des DFV für sich das Beste herausgeholt. Die Fußballlandschaft im Osten hat sich bis heute nicht davon erholt.
Die seltenen Aufstiege der ehemaligen DDR-Vereine in den unteren Spielklassen werden gefeiert wie große Titel. Manchmal träumten Fans und Vereine von einem Investor aus Spanien, vom Profifußball und vielen Millionen, und vieles endete immer und immer wieder noch einmal in Träumerei – so viele Pleiten und Neugründungen seit der Wende.
Es sind dies die großen Jetzt-Bilder der Fußballeinheit. Der Harz steht dagegen als autarkes Fußballland genügsam in seinen eigenen Geschichten, die kaum über die Region hinaus gesendet werden. Hier ist alles etwas kleiner als groß.
In Drechsels Jugendzeit gab es einen großen Fußball-Wettbewerb zwischen den Orten. Heute müssen die Rivalen zusammenhalten – die Demografie. Die Orte sind ausgedünnt, die Klubs bilden Spielgemeinschaften. Der Turn- und Sportverein Wulften kommt bislang allein zurecht.
Torkönig
Heinz Oelze und Uwe Dittmann sind Männer, die sich damit auskennen, dass es kommt, wie es kommt. Beide waren Jugendtrainer Drechsels. Oelze, früher selbst Stürmer beim 1. FC Magdeburg in der DDR-Oberliga, wurde 1971 zum Militärdienst eingezogen und verpasste so die vielen Titel, die Magdeburg in den 70ern gewann, darunter den Europapokal der Pokalsieger 1974.
Einen „begnadeten Spieler, hochtalentiert“, nennen Oelze und Dittmann den jungen Drechsel. Als er acht ist, will ihn Magdeburg erstmals verpflichten. Die Eltern wollen noch nicht. Drechsel bleibt in Blankenburg und sorgt für Vereinsrekorde. Als die C-Jugend 1993 durch ein 2:0 gegen den Halleschen FC Landesmeister wird, hat er 112 Saisontore geschossen. Im Jahr davor waren es 162, davon 40 in einem einzigen Spiel. Es gibt wohl niemanden in der Region mit mehr Pflichtspieltoren seit der Wende. Mike Drechsel, Torschützenkönig im wiedervereinigten Fußballland Harz. So in etwa.
Für Heinz Oelze und Uwe Dittmann waren die Jahre mit Drechsel besondere Jahre. Schnell schwelgen beide. Dittmann erinnert sich an ein Spiel gegen Lokomotive Stendal: „Mike hatte das 1:0 gemacht, dann musste ich ihn rausnehmen, er hatte sich die Schulter ausgekugelt. Zur Halbzeit lagen wir 1:4 zurück, und er wollte es unbedingt noch mal versuchen. Wir haben ihm einen Verband gemacht. Und dann habe ich den Mike also wieder gebracht. Der Junge hat noch vier Tore geschossen und wir haben 5:4 gewonnen.“
„Fußballspiele und lokales Fantum waren immer ungeheuer wichtig für die Leute im Harz“, sagt Oelze. Anders als bei allem anderen, schienen hier Anzeichen eines Aufschwungs wirklich durchschimmern zu können. Und Drechsel war ihr Konjunkturpaket. „Dem Mike haben sie schon in der Jugendzeit gerne zugeschaut”, sagt Dittmann, „zu den wichtigen Spielen kamen drei-, vierhundert Zuschauer.“
„In Magdeburg, glaube ich, haben sie ihm einfach zu wenig Pause gegeben. Haben ihn gleich in drei Mannschaften spielen lassen“, sagt Uwe Dittmann. „Verprellt“, sagt Oelze. Die Hochzeit von Sportschulen und Leistungszentren der Jugendabteilungen im Osten sind da längst vorbei. Vorbei die Jahre, in denen Talente intensiv gefördert und nicht mehr losgelassen wurden. Mit 18 hatte der kleine Heiland aus dem Hinterland seinen dritten Meniskusschaden.
„Ich habe in den letzten DDR-Jahren in Blankenburg noch erlebt, was Jugendförderung bedeutete. Ich hatte Ansprechpartner. Mit zehn habe ich an fünf Tagen in der Woche trainiert. Nach 1990 musste ich dafür nach Duisburg fahren“, sagt Drechsel, „oder wenigstens nach Magdeburg. Die alten Leistungszentren sind einfach verrottet. Kein Geld mehr. Ging alles den Bach runter.“
Die ältere Fan-Generation im Osten fühlt sich nach der Wende betrogen. Betrogen vom Geld aus dem Westen, das ihre Helden lockte, betrogen von den Vereinen, die nicht mehr die ihren waren.
Die Selbstzufriedenheit des DFB mit Art und Weise der Fußballeinheit gipfelte nach dem WM-Sieg 1990 in Franz Beckenbauers Jubel-Nebensatz: „Jetzt sind wir auf Jahre unschlagbar.“
Erst nachdem sich die deutsche Nationalmannschaft – gealtert, dann notdürftig verjüngt und vor allem im Sturm in Not – bei der WM 1998 in Frankreich mit einem 0:3 gegen Kroatien aus dem Turnier verabschiedet, beschließt der DFB, die Jugendarbeit zu reformieren. Das Modell der DDR-Sportschulen wurde zum heimlichen Vorbild.
Die neue Attraktivität der Fußball-Bundesliga, die Rede von der goldenen Generation in der Fußball-Nationalmannschaft, „das hat alles auch zu tun mit dem Erinnern an die Strukturen der Jugendförderung in der DDR“, sagt Drechsel.
Heute gibt es wieder junge Spieler aus dem Osten, die es bis nach ganz oben schaffen. Der Nationalspieler Marcel Schmelzer von Borussia Dortmund etwa, der in der Jugend wie Drechsel für den 1. FC Magdeburg spielte.
Den Harz aufwecken
Anpfiff in Wulften. Es ist ein Sonntag im Juni. Den Ort durchzieht Leere. Die Schilder im Ortsinneren: „Deppe Kaffeethek“, „Agrar Markt Deppe“, „Sport Center Ringmann“ und endlich „Waßmannstraße, Sportplatz“. Die Waßmannstraße ist die lebendige Spur.
„Kommt sehr darauf an, wie wir reinkommen“, hatte Trainer Stephan Strüber am Vormittag gesagt, und Wulften kommt gar nicht gut rein, zu unsicher das Passspiel am Anfang, ein Wimmelbild. Der Gegner hat Chancen.
Vorstellbar, dass ein junger Drechsel den Ort aufwecken könnte, wie damals, 1999, bei seiner kurzen Rückkehr nach Blankenburg.
Ein Bekannter aus Drechsels Jugendverein bittet ihn nach dessen Rauswurf beim 1. FC Magdeburg zu helfen. Blankenburg ist Tabellenletzter in der Verbandsliga, akute Abstiegsgefahr.
„Die Leute gingen hier plötzlich wieder zum Fußball“, erinnert sich Uwe Dittmann. Drechsel machte bum, dann machte er bum, bum, dann hieß es: gut gemacht, Mike, dann gab es ein Bier. 1000 Leute schauten zu, wie Drechsel die Gegner auseinandernahm, und auch auswärts kamen die Fans, mit dem Schönes-Wochenende-Ticket durch Sachsen-Anhalt.
In der Rückrunde schoss Drechsel den Verein bis auf den zweiten Platz. Für den Aufstieg in die Oberliga reichte es nicht ganz. Aber fast. Bestätigung aus der Nähe tut ihm gut, sie hilft, man merkt Drechsel seinen verborgenen Stolz hinter den bescheidenen Worten an. „Schön, dass endlich jemand meine Geschichte erzählen möchte“, sagt er.
Mit Anfang 20 bekommt Drechsel noch einmal Angebote aus Berlin, Leipzig und Braunschweig, aber das bedrohliche Leben außerhalb des Fußballplatzes drängt sich auf. Drechsels Mutter stirbt an Krebs. Der Sohn möchte in der Nähe des Vaters bleiben. Er hat keine Lust auf Berufsnomadentum, auf mageres Geld und viele Vereinswechsel, bis der Körper nicht mehr kann.
Möglicherweise ist es auch ein Akt des Stolzes. Dass es nicht mehr geht wie von selbst. Misstrauen gegenüber zu vielen Zufälligkeiten, Verletzungen. Vielleicht beginnt hier die Geschichte des Vernunftfußballers, der dem ewigen Versprechen des Spiels und seiner Wunderkraft nicht mehr ganz vertrauen mag.
Die Küsse, die Mädchen
„Mir war wichtig, erst einmal meine Kaufmannslehre zu machen“, sagt Drechsel. Die plötzliche Lebensidee mit Anfang 20: Sicherheit und Familie und einen Ort, der einen kennt. Der Harz ist ein schönes Versteck.
Zehn Jahre spielt Drechsel zehn Kilometer nördlich von Wulften in Petershütte fünfte Liga. Der neue Klub gibt ihm einen Ausbildungsplatz, dann einen Job in einem Sportgeschäft. „So läuft es bei uns“, sagt Drechsel, „vom Fußball zur Arbeit zum Fußball.“
Wenn der große Traum ausgeträumt ist, bleiben Geschichten, die möglichst nah dran sind an den einst geträumten Bildern. Charmante Episoden und Einmaligkeiten, Drechsel kann gutlaunig erzählen davon: „Einmal war ich die komplette Hinrunde verletzt. In der Rückrunde habe ich in 15 Spielen 37 Tore geschossen.“
Seine Frau hat Drechsel auf einem Vereinsfest kennengelernt. „Muss man auch erst mal schaffen“, sagt er, „gibt ja kaum welche bei uns.“ Drechsel kümmert sich um seinen Vater, der einen Schlaganfall hatte, der noch immer in Blankenburg wohnt, der sagt: „Alte Bäume verpflanzt man nicht.“
Funktionieren denn Fußballstatistiken bei den Harzer Mädchen? „Kompletter Quatsch, nee, natürlich nicht“, sagt Drechsel. „Denen muss man schon was anderes erzählen, mehr so uff nett.“ Ob Drechsel gerne küsst? Er brummt, und er lacht. Er sagt „hm!“
„Harz ist Heimat“, sagt Drechsel. „Hier habe ich etwas für mich gefunden.“ Es sind Sätze, die einleuchten sollen. Er gehört dazu, das möchte er, hier ist er wer. Drechsels wache Augen leuchten. Es scheint ihm sehr plausibel, dass alles wurde, wie es ist.
Im vergangenen Jahr kommt es dann zum Wechsel nach Wulften. TSV Eintracht Wulften von 1904, gegründet von Turnbruder Hermann Müller. Der Verein verschafft Drechsel einen festen Job als Lagerist. Das Sportgeschäft in Petershütte gibt es nicht mehr.
Ehrensache
Noch ist es ruhig um das Wulftener Spielfeld, auf den Bänken, an der Würstchenbude, vor dem Vereinsheim. Das ganze Dorf ist gekommen, vielleicht nur das halbe, die Augen scannen das Spielfeld, es darf jetzt bitte gerne etwas losbrechen.
„Ehrensache, dass es heute klappt“, hatte Drechsel gesagt. „Hoch, ruff, uffsteigen!“
Und was hier alles in den Himmel raufragt: Hobbyfunkerantennen, Windräder, ein Mast mit Deutschlandfahne; die Zuschauertribüne, Jubelarme und weiter und höher der Ball, der nach 20 Minuten endlich ins Tor fliegt, dass die Jubelarme einander umarmen dürfen, weil Wulften wird Meister, ganz sicher, das geben sie jetzt nicht mehr her.
Stephan Strüber gibt den kurzen Befehl: jetzt nicht nachlassen! Die Worte des Trainers sind knapp und klar, kein schrilles, misstönendes Kläffen. Strüber, jovial, seriös – der richtige Coach für eine gut kickende Freizeitmannschaft.
„Du bist der beste Trainer, den wir uns vorstellen können“, werden sie später über ihn sagen, und Strüber wird gerührt sein, richtig dosiert natürlich, wie es sich gehört, und er wird sich bedanken und ein Bier nehmen und etwas langsamer trinken als seine Jungs. Und Strüber wird sagen, dass er froh ist, dass „der Mike“, den sie auch hier „Knipser“ nennen, Anfang der Saison nach Wulften kam. Dass er gut reinpasst und das alles.
Strüber steht Höhe Mittellinie und streichelt den Bart. Das ewige Trainergesicht: Skepsis bis Spielende. Zwischendrin kommt jemand, schüttelt die Hand, klopft die Trainerschulter, sagt „tag Stephan!“, erkundigt sich, ob der Mike schon getroffen hat und nimmt einen Platz in der Nähe. Da dann stehen. Gucken. 1:0 also, angespannte Ruhe, aber es läuft ja auch gut.
Der Gegner spielt ein unzeitgemäßes Spiel langer Bälle nach vorn. Wulften spielt, wenn sich alle zusammenreißen, kurze Pässe, Drechsel spielt immer noch Sturm. Vom gelegentlichen Gefuchtel der jüngeren Spieler hebt er sich ab. Drechsel tut das Nötigste, um immer sehr gefährlich zu bleiben vor dem Tor der anderen. Ohne große Hinundherverschiebung, beinahe kauernd steht er da, sehr robuste Einsachtundsechzig, kein Mann, der gerne läuft, dafür in der Regel richtig, konkret und genau. Er ist ein Schleicher im Strafraum, es reicht eine vom Gegner nicht für möglich gehaltene Bewegung. Drechsel hat in den vergangenen beiden Saisonspielen sechs Tore gemacht. Er kann ein Spiel sabotieren.
Andreas Petersen, der Vater von Nils Petersen, den der FC Bayern aus Cottbus holte und nach Bremen gab, sagt über Drechsel den unvermeidlichen, aber ehrlich gemeinten Satz: „Er war einer, der es hätte schaffen können.“ Als Trainer des SV Südharz musste er seine Abwehr einst auf die grandiose Abschlussstärke Drechsels einschwören. Seit einer Saison trainiert Petersen den 1. FC Magdeburg, sein Sohn Nils steht vor dem Durchbruch in der Bundesliga. „Er ist einer, der es schaffen kann“, sagt Drechsel.
Wulftener Jungs
In Wulften steht es 5:0. Stephan Strüber steht immer noch am Spielfeldrand, Mike Drechsel noch immer lauernd Höhe Strafraumgrenze. Wieder und wieder wird der Schweiß geschüttelt, Wulften rennt an, Drechsel steht frei und schiebt ein.
Das Unbesondere, die Abgeklärtheit im Umgang mit allen und allem, ist in Wulften Trumpf. Nur im Spiel und im Sprechen über die vergangenen Spiele zeigt sich die Aura der Einmaligkeit, die Zeit an Drechsel, in Drechsel und um ihn herum.
1974, als der 1. FC Magdeburg im Finale des Europapokals der Pokalsieger den AC Mailand mit 2:0 besiegte, waren weniger Magdeburger im Stadion De Kuip in Rotterdam als heute Wulften-Fans in Wulften. Die Magdeburger durften beim alles überragenden Triumph des DDR-Fußballs nicht reisen.
In der Wulftener Mittagshitze pochen die Schläfen, die letzten Schritte der Saison, milde, matt und wohl. Und dann feiern sie den Abpfiff, die Party wird angeworfen, so geht es den Abend, die Nacht, die ganze Nacht lachen und morgen Vormittag weiter mit pelziger Zunge.
Mike Drechsel sitzt auf dem Rasen vor dem Vereinsheim. Er schaut auf seine Torjägerkanone und trinkt ein Radeberger aus der Flasche. Es ist das fünfte seit Spielschluss, das war vor einer halben Stunde, er haut es weg, das sechste Bier. Drechsel wollte kürzertreten. Jetzt ist er aufgestiegen, mit 33, er macht noch mal einen Schritt nach vorn. „Bezirksliga – wir sind wieder da“ steht auf den neu beflockten Meister-T-Shirts. Drechsel war da noch nie.
Der Knipser, das vielleicht letzte große Mittelstürmertalent der späten DDR, in seinem 34. Jahr: hohe Siege, viele Tore. „Eine Spaziergangsaison“, sagt Drechsel und fasst sich ans Knie. In der Sommerpause wird sein Meniskus operiert. „Der Hüftschwung hat nachgelassen“, sagt er, und „das nächste Spiel ist immer eins weniger“, fällt ihm noch ein.
„Mach mal Sonne, aber nicht zu doll“, hatten die Wulftener Jungs gesagt nach dem Regenspiel im Nachbarort Pöhlde am vorletzten Spieltag.
Und die Sonne glüht, dass das kühle Bier warm wird. Drechsel holt noch eins, die Freundin, die Töchter, da kommt der Handkuss von der Tribüne – völlig zu Recht.
© Jasper Fabian Wenzel · Welt am Sonntag, 7. Oktober 2012
Texte
Veröffentlichungen
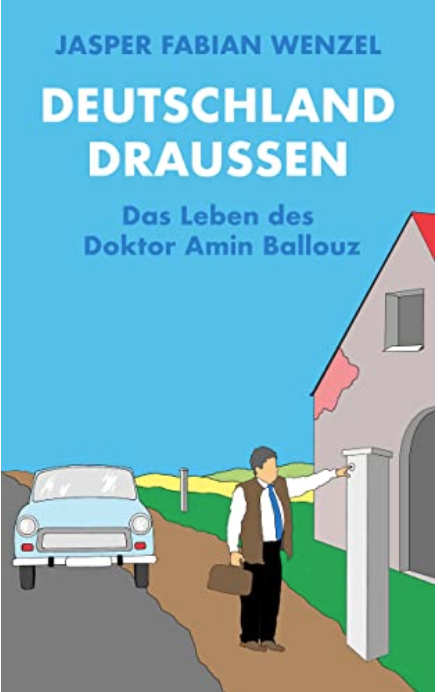
DEUTSCHLAND DRAUSSEN
Wieder bei Null anfangen, so hat er angefangen: In Beirut geboren, flüchtete Amin Ballouz als 17-Jähriger aus dem Libanon und kam nach einer Odyssee zum Medizinstudium in die DDR. Kurz vor der Wende ging er in den Westen, arbeitete in London und Paris und kehrte in den Nullerjahren nach Deutschland zurück, als Landarzt in die Uckermark. Der Libanese Ballouz, ein wunderbarer Parleur, scheint ein Glücksfall für die Menschen hier. Seine Heiterkeit lehnt sich auf gegen die vordergründige Tristesse, die Müdigkeit und Blässe der schrumpfenden Kleinstädte, Kleindörfer, Kleinode. Ballouz spricht von Einmaligkeit, wenn er von den Menschen erzählt, die er hier kennenlernt. Ihre Erzählungen spiegeln die deutsch-deutsche Geschichte, ihr Kollidieren mit den turbulenten Weltkrisen der jüngeren Tage, den Alltag eines allmählich verödenden Landstrichs. Ballouz fühlt sich als Vermesser, will von den Geschichten lernen, von allem, was dort lauert, wächst, leise tobt, versinkt. Viele Patienten teilen Ballouz‘ Vertriebenenschicksal, die Flucht aus der Heimat. Wenn er sie trifft, sagt er, trifft er auch sich selbst.
Deutschland draußen – Das Leben des Dr. Amin Ballouz
dtv premium, München 2015
176 S., Paperback Originalausgabe
Neuausgabe 2022
Kindle-Edition
Auch verfilmt als TV-Serie „Doktor Ballouz“ (2021-) im ![]() .
.
Deutschland draussen
Das Leben des Doktor Amin Ballouz
IMPRESSUM
Für den Inhalt der Seite verantwortlich gemäß § 55 Abs. 2 RStV:
Jasper Fabian Wenzel
Christburger Str. 49
10405 Berlin
BILDMATERIAL
Bernhard Moosbauer
Charlotte Schmitz
Jan Zappner
HAFTUNGSAUSSCHLUSS (DISCLAIMER)
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter bin ich gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG bin ich als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werde ich diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Diese Homepage enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte ich keinen Einfluss habe. Daher kann für diese fremden Inhalte meinerseits keine Gewähr übernommen werden. Für Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße geprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors/Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitte ich um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich entsprechende Inhalte umgehend entfernen.